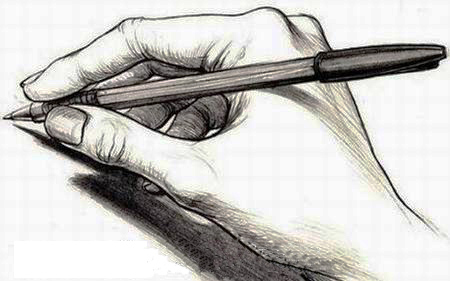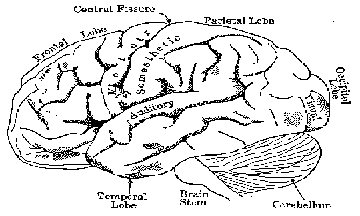In der Konsumgesellschaft leidet die seelische Reife. Die moderne Geldwirtschaft arbeitet gegen die Gefühle der Menschen. Der Kapitalismus zerstört die Empathie.
In der Konsumgesellschaft leidet die seelische Reife. Die moderne Geldwirtschaft arbeitet gegen die Gefühle der Menschen. Der Kapitalismus zerstört die Empathie.
»Dichter sehen noch zusammen, was die Wissenschaft trennt«, schreibt Wolfgang Schmidbauer in seinem neuen Buch. Von den früh vollendeten Dichtern, deren Tod Phantasien weckt, was aus ihnen noch alles hätte werden können, ist Wilhelm Hauff einer der bekannteren. Als sein wichtigstes Märchen gilt Das kalte Herz, Teil der Märchensammlung Das Wirtshaus im Spessart. Der Held dieses Märchens, der Kohlenmunk-Peter, will gerne mehr sein, als er ist, weshalb er sein Herz an einen Sendboten des Bösen verkauft, den Holländer-Michel, der das Holz aus dem Schwarzwald teuer in Holland verkauft und so der Repräsentant einer frühen Globalisierung wird. Symbol dafür ist das Herz aus Stein, das reich macht – und kalt bleibt, wenn die Armen klagen.
Wie Peter sein Herz wiedergewinnt und was wir heute tun (und lassen) müssen, um unsere Gefühle nicht ganz zu verlieren, darüber gibt uns Wolfgang Schmidbauer in seiner luziden, mit zahlreichen Beispielen aus Familien- und Liebesbeziehungen ergänzten Analyse überzeugend Auskunft.
Bei Amazon bestellen
Interview im Zeitmagazin:
„Unser Lebensgefühl ist Unsicherheit“

 Aus einer Rezension von Christine Kanz, erschienen in: Jahrbuch für Literatur & Psychoanalyse. Freiburger literaturpsychologische Gespräche, Bd. 31, 2012
Aus einer Rezension von Christine Kanz, erschienen in: Jahrbuch für Literatur & Psychoanalyse. Freiburger literaturpsychologische Gespräche, Bd. 31, 2012