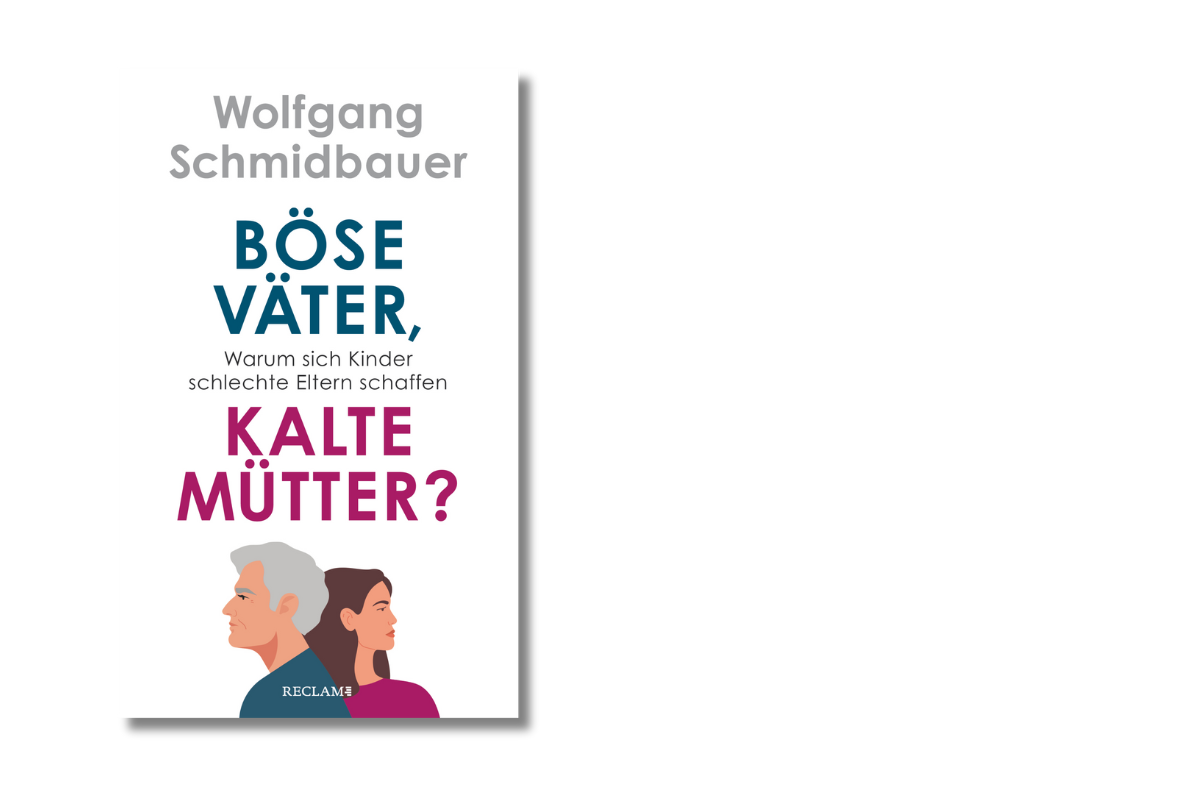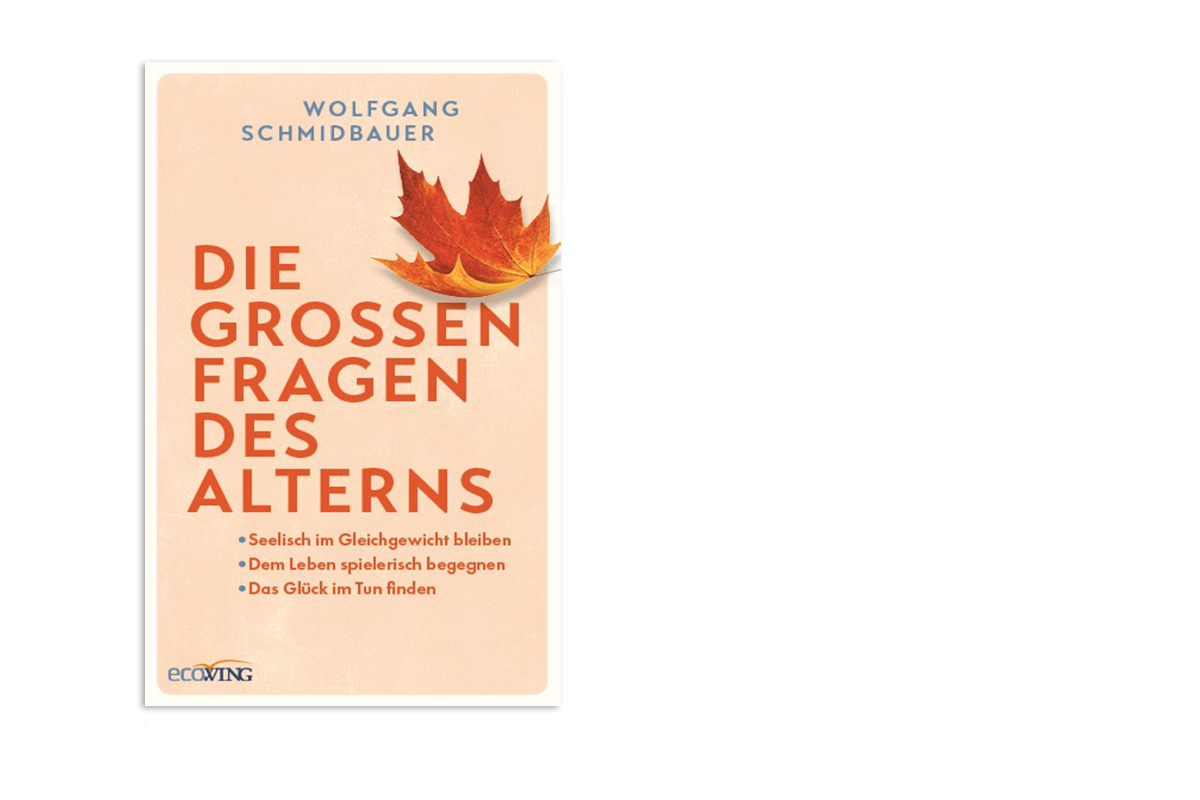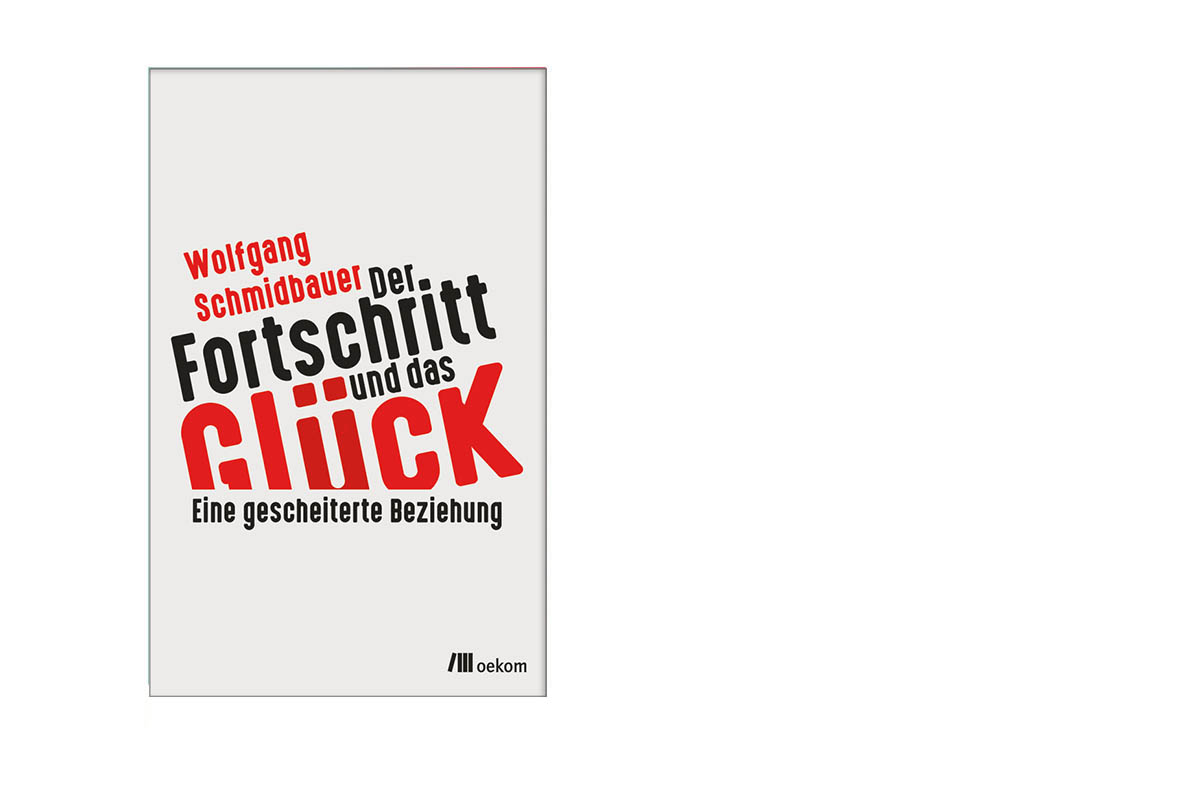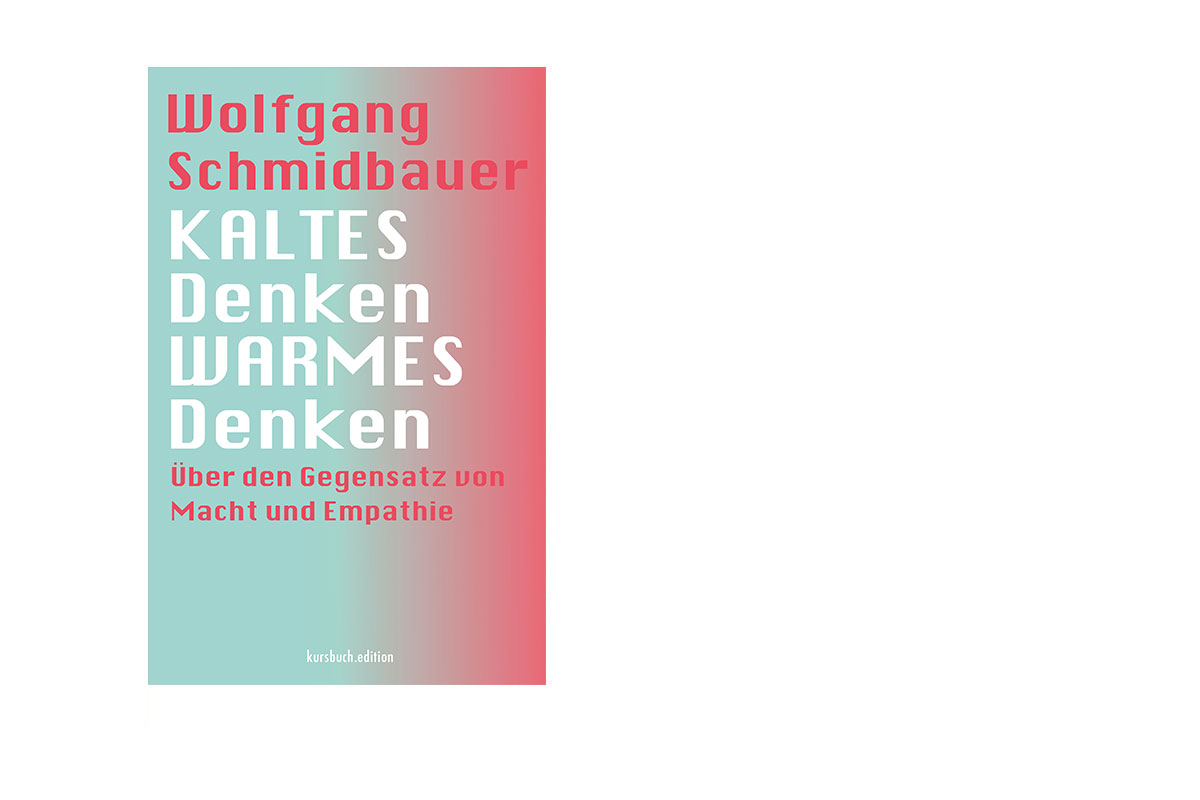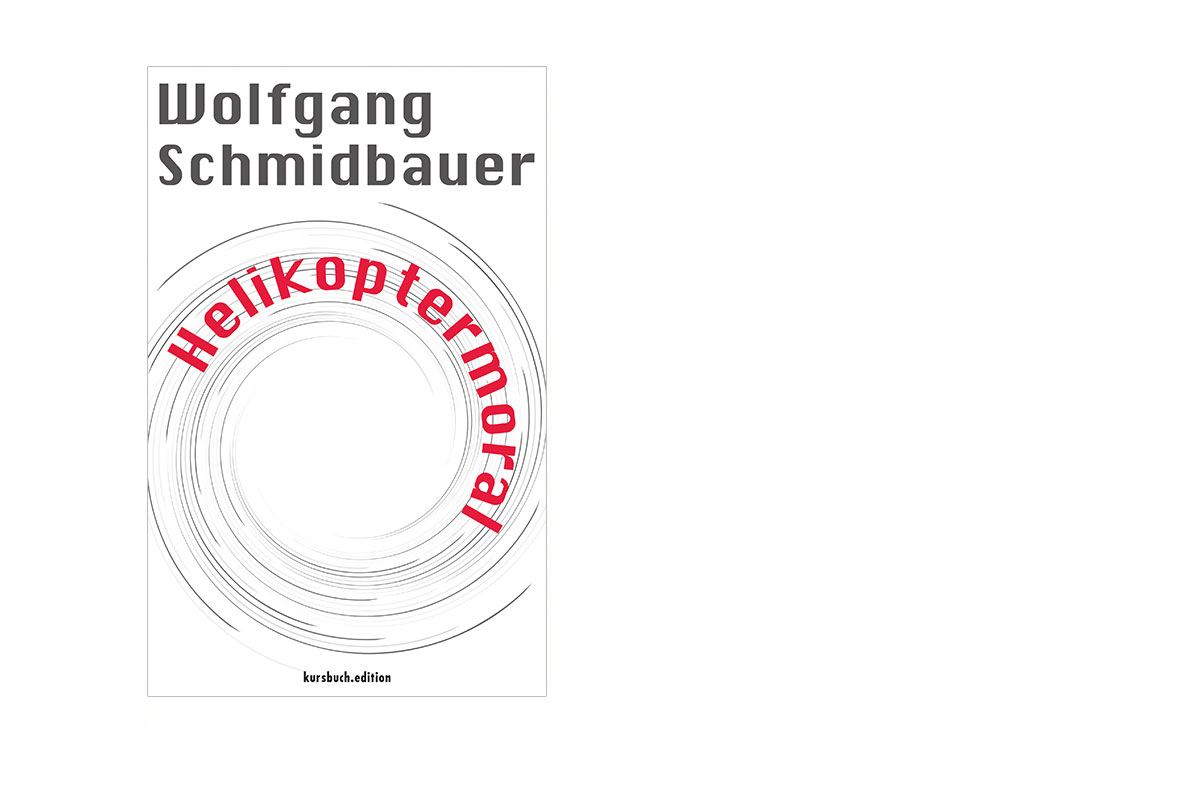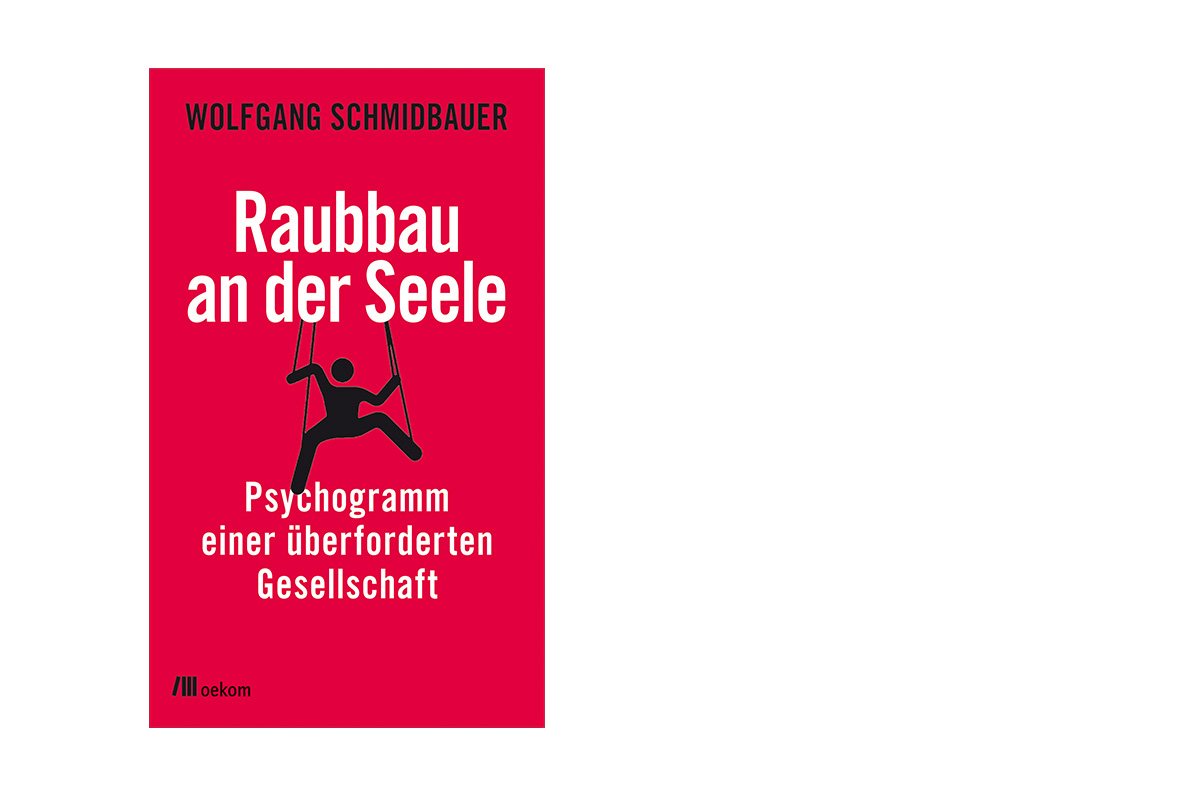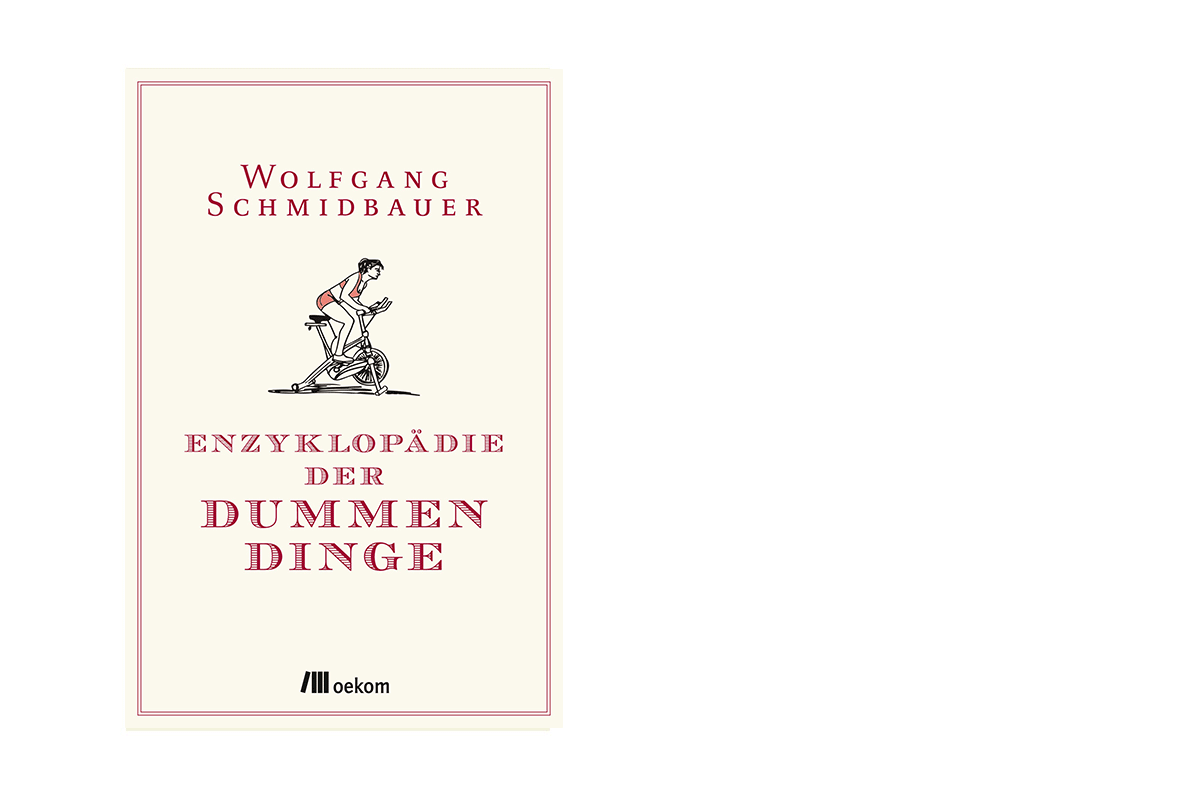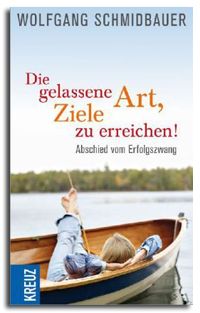pannungen in der Familie treten besonders gerne dann auf, wenn sich die Geschwisterkonstellation zu Hause ändert: Der bekannte Autor und Psychologe Wolfgang Schmidbauer geht in seinem aktuellen Sachbuch der Frage nach, ob es Erstgeborene tatsächlich schwerer im Leben haben als alle nachfolgenden Familienmitglieder: Welche Dynamiken entstehen, wenn weiterer Nachwuchs da ist, und welche Folgen hat die veränderte Rolle zwischen Rivalität und Nähe für große Brüder oder ältere Schwestern?
Immer mehr Menschen denken, nicht sie selbst, sondern ihre Eltern seien die Schmiede ihres Glücks. Kritik an schlechten Eltern ist etabliert, anklagende Kinder dürfen Kinder bleiben, Verständnis und Mitgefühl erwarten. Aber: Die Opferrolle erkauft kurzfristige Entlastungen teuer und führt nicht selten in eine Sackgasse.
Wie gehen wir damit um, dass wir älter werden? Was können wir schon weit vor der Rente tun, um uns darauf vorzubereiten? Der renommierte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer hat sich den großen Fragen des Alterns angenommen. Er packt die Probleme am Schopf und zeigt auf, wie wir unseren Ängsten begegnen und die Lebensqualität im Alter bewahren können!
Unsere Zeit ist von einem seltsamen Widerspruch geprägt: Obwohl uns der Fortschritt immer mehr Wohlstand und Sicherheit bringt, leiden immer mehr Menschen an Depressionen und Ängsten.
Geplagt von Verlustängsten und angehalten zum steten Konsum haben wir verlernt, uns selbst zu lieben, und passen stattdessen unsere Körper an gesellschaftliche Wunschbilder an. Ein Plädoyer für mehr Empathie und Gelassenheit im Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen.
In seinem neuen Buch verhandelt Wolfgang Schmidbauer die prototypischen Bereiche des kalten und warmen Denkens: Angefangen bei der Jurisprudenz, der Mathematik und Naturforschung auf der einen, hin zu Kunst, Medizin und Psychologie auf der anderen Seite. Dazwischen der Mensch. Und das, was er von der Temperatur von Gefühlen lernen kann.
Die globalisierte Konsumgesellschaft plagen chronische Ängste. Sie verschwendet mehr als nachwächst, sie weckt den Neid der Habenichtse und den Terror der Gekränkten. Diese Ängste münden in Hyperaktivität, sei es des Übereifers, sei es der unverhältnismäßigen, verschwenderischen Reaktion auf konstruierte Gefahren. Wie ihr Pendant, die Helikoptereltern, ist auch die Helikoptermoral immer schon da, immer bereit, Stellung zu beziehen.
Der moderne Mensch betreibt doppelten Raubbau – an seinen physischen wie psychischen Ressourcen. Zu Verschmutzung und Übernutzung unserer Um-Welt gesellt sich immer öfter eine lähmende Erschöpfung des Ich; aus Homo sapiens wurde Homo consumens, dem Überfluss folgte Überdruss.
Sie haben unseren Alltag bereichert und erleichtert: Kühlschrank, Dusche, Smartphone - darauf verzichten möchte niemand mehr. Wir nutzen diese Dinge heute völlig selbstverständlich, ohne darauf zu achten, wie sie - im Hintergrund unseres Lebens - Fühlen und Denken der Gesellschaft verändern.
Die Macht seelischer und sozialer Einflüsse auf körperliche Leiden wird fast immer unterschätzt. Obwohl viele dieser Zusammenhänge seit langem bekannt sind und immer wieder betont wird, dass z.B. mindestens die Hälfte aller Kranken in einer durchschnittlichen Allgemeinpraxis an psychosomatischen Erkrankungen leidet, geht dieses Wissen auch immer wieder verloren, die Patienten erleben (und werden dazu angeleitet) ihre Rückenschmerzen, ihr Rheuma, ihre Atembeschwerden oder ihre Infektanfälligkeit als „rein organisch“ oder sagen abwehrend „ich weiss schon, es ist psychosomatisch“.
In dem vorliegenden Text unterscheide ich zwischen einer Organsprache und einem Organdialekt: Wer Symptome lexikalisch „übersetzen“ will (z.B. Asthma ist „der Schrei nach der [...] → weiterlesen.
Ablenkungsmöglichkeiten gibt es in unserer Gesellschaft ohne Ende; was nicht gefällt, wird weggezappt. Dranbleiben hat hingegen mit Gelassenheit zu tun, mit langem Atem...