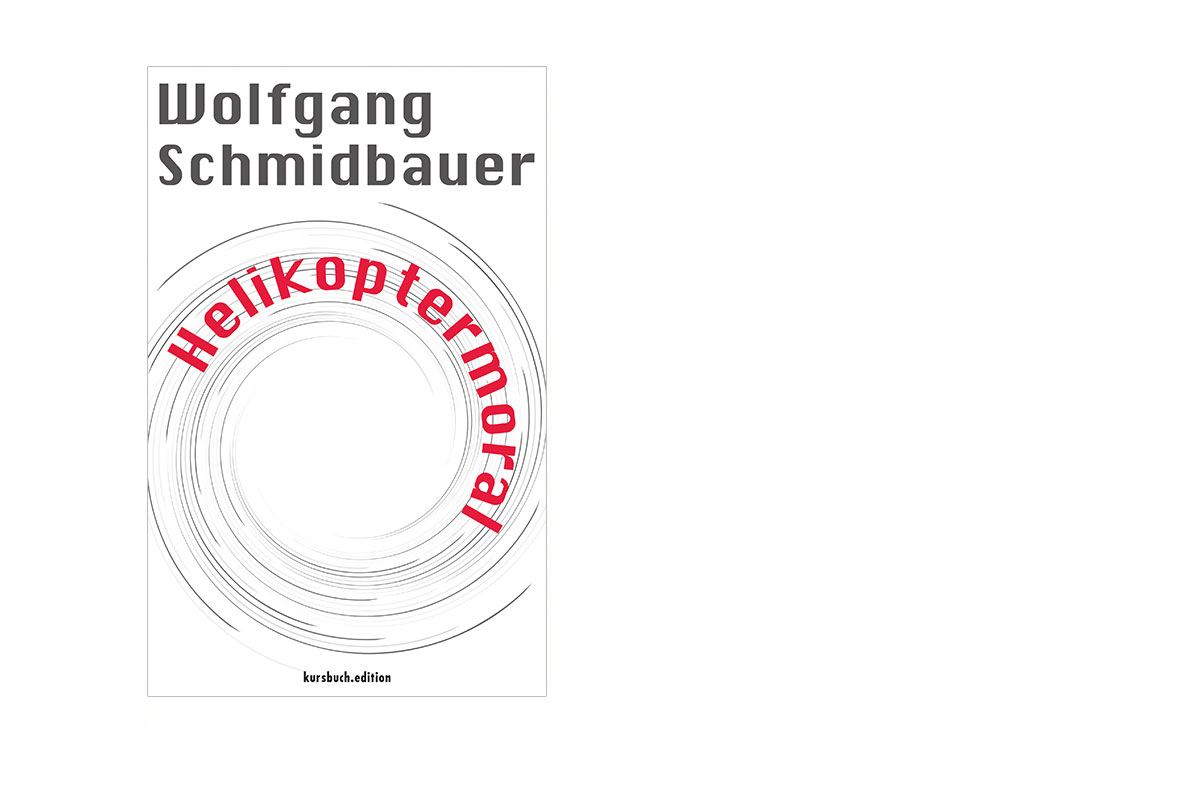SZ Magazin: Nach 1918 sind viele Menschen an Depression erkrankt, die die Spanische Grippe überlebt hatten. Wie ist das zu erklären?
In Zeiten der Rekonvaleszenz werden viele Leute depressiv, deswegen macht man ja auch Rehabilitationen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es außerdem unglaublich viele Umbrüche: Wer da nicht ganz fit war, war anfälliger für Depressionen. Soldaten sind das ohnehin, sie haben leicht das Gefühl, das Vaterland vergilt ihnen ihr Leid nicht. Die Integration der Soldaten im Frieden ist nach jedem Krieg ein Riesenproblem.
Ist so eine Häufung von Depressionserkrankungen auch durch Corona zu erwarten?
Das ist sehr schwierig zu vergleichen, auch weil damals unglaublich viele junge Menschen gestorben sind, während Covid 19 ja vor allem durch die Gegenmaßnahmen das öffentliche Bewusstsein geprägt hat. Vergleichbar wäre allenfalls, dass im Weltkrieg der manische Fortschrittsglaube zusammengebrochen ist, der die „Gründerzeit“ geprägt hatte, und heute der manische Wirtschaftswachstumsglaube zusammenbricht, nicht allein wegen Corona, auch wegen des Klimawandels und der langsamen Krise der Verschwendungs- und Müllwirtschafterei.
Wann wird man depressiv?
Vor Depression schützt ein Gefühl der Selbstwirksamkeit: Ich kann irgendetwas machen. Der Mensch ist so konstruiert, dass er in der Früh mit Hunger aufwacht. 99 Prozent unserer Existenz auf der Erde war das so. Der Mensch erwachte hungrig und suchte essbare Pflanzen oder jagte. Wenn er etwas gefunden oder erbeutet hatte, ging es ihm gut. Er konnte etwas machen, um das ungute Gefühl am Morgen selbstwirksam zu beseitigen. In der Zivilisation fällt das weg, stattdessen wacht man auf und macht sich Sorgen. Sobald die Sorgen sich multiplizieren, läuft man Gefahr, die negative Stimmung nicht mehr loszuwerden. Arbeitslosigkeit, Verlust von Angehörigen, Stress in Beziehungen – das sind dann die Auslöser von Depressionen, einer typischen Krankheit der Moderne.
Der ursprüngliche Zustand des Menschen ist also einer der Unzufriedenheit und des Unglücks?
Nein. Hunger ist kein Unglück, Hunger aktiviert. Dauernde Angst macht unglücklich. Chronische Angst bedeutet großen Stress. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war ein unglaublicher Zivilisationsbruch. Der Glaube an die Moral und den Fortschritt ist da kollabiert. Die faschistische Bewegung kann man ja auch als manische Abwehr dieses Zusammenbruchs verstehen. Aus allen möglichen Bruchstücken – Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus – wurde da eine Weltanschauung gebastelt, mit der man die Niederlage abtun konnte.
Man nennt die Spanische Grippe auch die vergessene Pandemie.
Damals waren die meisten Menschen durch den Krieg traumatisiert die Pandemie ist quasi auch in dem allgemeinen Umbruch untergegangen und vergessen worden. Es sind viele Leute daran gestorben, gerade junge Menschen, es war viel schlimmer als Corona, aber man hat die Spanische Grippe mit einem heute kaum vorstellbaren Fatalismus hingenommen. Die Menschen litten, aber niemand dachte daran, das Leben stillstehen zu lassen. Man hat die Grippe nicht groß zum Thema gemacht, obwohl die Schulen geschlossen und ein paar andere Maßnahmen ergriffen wurden.
Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie fanden nicht nur Beifall.
In den Reaktionen wurde ein Generationenkonflikt deutlich: Die Kritiker der Maßnahmen unter den Epidemiologen waren älter, sie meinten, wenn es den Test nicht gäbe, hätten wir das hingenommen wie eine schwere Grippewelle. Aber es ist viel leichter, zu kritisieren als es richtig zu machen. Ganz neu ist, dass die Infizierten und Toten jeden Tag in der Zeitung stehen, wie während der Olympiade die Medaillen. So entsteht ein enormer Druck.
So ein Standpunkt wäre doch allenfalls von jungen Virologen zu erwarten gewesen?
Erstaunlicherweise haben die jungen Virologen eben nicht die Interessen ihrer Generation vertreten.
Erst hieß es, Lungenautomaten könnten die meisten Patienten retten, dann zählte man doch viele Tote auf der Intensivstation. Kann die Uneinigkeit unter Virologen über Übertragung und geeignete Gegenmaßnahmen Menschen verzweifeln und depressiv werden lassen?
Es gab viel Latrinenparolen, aber einige Erkenntnisse waren gesichert. Die Möglichkeiten einer Epidemie zu begegnen sind fortgeschritten. Intensivstation bedeutet halt, ungefähr fünfzig Prozent der Patienten sterben. Ohne Intensivstation wären es alle. Die Politik musste sich 1919 nicht um Intensivbetten sorgen, es gab keine. Die Medien haben viel Angst und viel komische Hoffnungen produziert. Ich las einmal, ein Wundermittel sei entdeckt worden: Cortison! Das gab es 1919 nicht, aber heute doch schon eine ganze Weile, und es ist wirklich sehr nützlich, aber kein „Medikament“ gegen Covid 19! Alles wurde hochgekocht. Bei der Hongkong-Grippe gab es 1968 auch eine unglaubliche Steigerung der Todesrate, ich habe die noch erlebt. Ein, zwei Millionen mehr Tote als in anderen Jahren, aber in der Süddeutschen stand es nur im Kleingedruckten. Die Schulferien wurden verlängert, ich war damals Medizin-Journalist, die Grippe war nicht wichtig, stattdessen hat man über die erste Herztransplantation berichtet. Dass mehr Leute mit chronischer Bronchitis oder eingeschränkter Lungenfunktion oder mit schweren Herz-Kreislauf-Problemen gestorben sind, ganz ähnlich wie heute, hat damals niemanden groß beschäftigt.
Glauben Sie, die Unsicherheit unter Wissenschaftlern ist heute geringer als früher?
Der Druck ist heute viel größer. Die Frage, wie gefährlich ein Virus ist, wurde in der Fachpresse diskutiert. Keine Tageszeitung hat sich dafür interessiert.
Werden der eingeschränkte soziale Kontakt, fehlende Zärtlichkeit und geringere Kommunikation während des Lockdowns zu einer Zunahme von Depressionen führen?
Ausnahmsweise vielleicht schon einmal, vor allem bei Menschen in Heimen, die plötzlich isoliert werden. Der Lockdown hat sicherlich Stress bedeutet, und Stress ist ein Auslöser von Depression, aber ich sehe eher die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen des Lockdowns zu einer Steigerung von Depressionserkrankungen führen könnte. Eine große Spaltung zeichnet sich in der Gesellschaft ab. Ich kenne einen Sportlehrer – für ihn was der Lockdown bezahlter Urlaub. Und eine Freiberuflerin – sie musste sich arbeitslos melden. Sie ist froh, freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt zu haben, denn sonst wäre sie jetzt auf Harz-IV angewiesen. Da gibt es unglaublich deprimierende Einzelschicksale, die überhaupt nicht durch staatliche Hilfen kompensiert werden können. Schon allein weil der Depressionsschutz durch die Selbstwirksamkeit ausfällt – ich verdiene meinen Lebensunterhalt durch etwas, was ich gerne mache. Das kann man nicht jemandem wegnehmen und sagen, du musst mit Harz-IV auskommen! Das ist eine psychische Risikosituation, die letztlich auch die Aggressionsbereitschaft in einer Gesellschaft steigen lässt. Früher haben die Armen bei einer Hungersnot Hass auf die Reichen entwickelt, die sich noch Brot kaufen konnten. Die einen haben durch den Lockdown ihre Sicherheit und Selbstwirksamkeit verloren, die anderen haben sie behalten. Das ist eine große Belastung für den Zusammenhalt.
Ist Depression nun genetisch veranlagt oder kann sie jeden ereilen, wenn nur der Stress zu hoch wird?
Unter massivem Stress – etwa in einem Vernichtungslager – werden wohl alle Menschen depressiv. Es gibt eine erbliche Disposition, die sich am besten als eine gesteigerte Sensibilität beschreiben lässt. Wenn jemand günstige Lebensbedingen hat, führt diese Veranlagung womöglich zu Kreativität, Feinfühligkeit, oft auch Tüchtigkeit.
Sie sprechen jetzt von dem, was man früher Melancholie genannt hat?
Bei Dürer galt sie als Zeichen des tiefen Denkers. Die modernen Lebensbedingungen laufen darauf hinaus, dass ein unerfüllbares Versprechen von der Gesellschaft gemacht wird, nämlich: Wenn du dich anpasst und deine Aggressionen unterdrückst, deine emotionale Autonomie einschränkst, wenn du also alles immer richtig machst und gute Noten schreibst und tust, was deine Vorgesetzten dir auftragen, dann wirst du glücklich werden. Ich sage überpointiert: Wer im Leben alles richtig macht, wird nicht glücklich, sondern depressiv. Es gibt Statistiken, welche Berufe besonders häufig unter Depressionen leiden und besonders oft Anti-Depressiva verschrieben bekommen. Das sind in Deutschland die Altenpfleger und die Mitarbeiter in den Callcentern. Kann man sich auch gut vorstellen, die kriegen sehr viele Aggressionen ab, müssen aber ständig freundlich bleiben. Ganz ähnlich in der Altenpflege. Das ist ein Beruf, der sehr viel Disziplin gegenüber den eigenen Aggressionen verlangt. Ein Kind ist dankbar, wenn man es versorgt, alte Menschen würden das lieber selbst machen und sind eher undankbar und wütend. Kein Wunder, dass Altenpfleger dreimal so oft an Depressionen leiden wie der Durchschnitt.
Sie glauben eher nicht an rein körperliche Ursachen für Depressionen? Also auch nicht an die Wirkung von Anti-Depressiva?
Das Modell einer genetisch bedingten Stoffwechselstörung, die durch Anti-Depressiva geheilt werden kann, ist ein Mythos. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Das Entweder-oder mit körperlicher Ursache auf der einen, seelischer auf der anderen ist Unsinn. Alles Seelische ist auch körperlich, das ist eine veraltete Diskussion. Genauso wie die Frage, ob Intelligenz angeboren oder durch die Umwelt gefördert ist. Sie ist immer beides.
Das heißt, Sie sprechen sich nicht in jedem Fall gegen Antidepressiva aus?
Ich persönlich halte nicht viel von ihnen und würde sie nicht schlucken. Es gibt Studien, dass sich ihre Wirkung wenig von der durch Placebos unterscheidet, aber es gibt Einzelbeobachtungen von Patienten, denen es damit wirklich besser geht, das will ich nicht wegdiskutieren. Außerdem gibt es auch eine psychologische Komponente in der Medikation: Normalerweise nimmt der Depressive die Haltung ein, dass er sich mehr anstrengen müsste, weil er sich für faul hält, einen Drückeberger. Der Patient hat ein schlechtes Gewissen. Was mit Medikamenten behandelt wird, ist nun eine echte Krankheit. Er muss sich nicht mehr vornehmen, sich mehr zusammenzureißen, sondern er ist wirklich krank, das bedeutet eine große Entlastung auf psychologischer Ebene.
Haben Sie als Therapeut nie Antidepressiva verschrieben?
Ich bin Psychologe und Psychoanalytiker, ich mache Gruppen- und Paartherapie. Ich darf gar keine Medikamente verschreiben, ich fände es auch nicht richtig, da sie oft Nebenwirkungen haben und man was vom Stoffwechsel verstehen muss, um die einzuschätzen. Die Behandlung der Wahl ist Psychotherapie, das sagen auch die Wissenschaftler in der Medizin. Was die Praktiker dann tun, um die depressiven Patienten ohne viel Zeitaufwand zu versorgen, steht auf einem anderen Blatt und dient vor allem den Interessen der Pharma-Industrie.
Ist das erste Ziel einer Therapie bei Depression, die Lebensumstände zu verändern, um wieder das, was Sie Selbstwirksamkeit nennen, erfahrbar werden zu lassen? Raten Sie dem Callcenter-Mitarbeiter nicht sofort zum Jobwechsel?
Zuerst muss die Psychotherapie erkennen, wie verarbeitet jemand seine Situation. Wenn er akzeptiert, dass die Situation viele Belastungen mit sich bringt, dann ist sie leichter zu ertragen, als wenn man denkt, ich bin ein Versager. Wenn man die Lebenssituation als schwierig akzeptiert, fällt es einem leichter, eine Lösung zu finden und sich neu zu orientieren. Das moderne Leben übt auf die Psyche einen Raubbaudruck aus. Der Anpassungsdruck im Job produziert eine riesige Abhängigkeit. Der Mann, der den Spruch „I love NY“, erfunden hatte, ist gerade gestorben. Er hat mal zehn Thesen veröffentlicht, wie man als Kreativer leben kann. Er zitiert darin John Cage, der im Alter von 74 gefragt wurde, wie man zufrieden altert. Cage sagte: „Nimm niemals einen Job an. Schau dass du jeden Tag das Frühstück für deine Kinder auf den Tisch bekommst, und das ist es dann. Mehr ist nicht zu tun.“ Das hat mich an die Geschichte der Jäger und Sammler erinnert. Aufwachen und schauen, was man jagen kann, und nicht denken, dass der Arbeitgeber dafür schon sorgen wird. Die Idee dahinter ist, dass man sich nie völlig abhängig machen und nie glauben darf, alles wäre sicher. „Wenn ich alles richtig mache, dann bleibt die Welt, wie sie ist.“ – Diese Lebenseinstellung führt zu großen Enttäuschungen. Auch in Liebesdingen. „Ich heirate eine Frau, mache alles richtig, bin ganz brav, ein guter Ehemann, stinklangweilig, meint die Frau irgendwann, verliebt sich in jemand anderen und haut nach zehn Ehejahren ab. Und der arme Kerl versteht nicht, warum, er hat ja alles richtig gemacht.
Die trügerische Illusion der Gewissheit.
Je früher jemand kommt, desto eher lässt sich diese Lebensstrategie noch ändern. „Du hast eine Stoffwechselstörung, die behandeln wir jetzt mit Medikamenten“, ist eine Konstruktion, die jemanden entlastet, der sich zu schwach fühlt, sein Leben noch zu ändern. Ich widerspreche in so einem Fall lieber nicht und rate nicht: Lassen Sie bloß dieses Gift weg. Das wäre übergriffig. Ich sage stets: Ich verstehe nichts davon. Wenn es Ihnen gut tut, nehmen Sie es. Sollte mich jemand fragen, erzähle ich auch von der dubiosen Wirksamkeit solcher Mittel, aber ich würde nicht die Initiative ergreifen und mich nicht einmischen.
Freiberufler und Künstler sind ja auch nicht frei von Depressionen.
Natürlich nicht. Auch Therapeuten nicht, die jede Menge bürokratischer Kontrollen über sich ergehen lassen müssen. Wir müssen Anträge schreiben und die müssen genehmigt werden. Ich betreue jetzt nur Privatpatienten und bilde aus, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, aber natürlich kann ich mich auch nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Irgendwann verschwinden die Privatversicherungen und dann kann es wirklich sein, dass ich Ärger kriege. Aber ich bin jetzt 79 und um jedes Jahr froh, das ich noch arbeiten kann.
Sind Therapeuten tatsächlich besonders disponiert für Depressionen?
Ja, wenn auch nicht so schlimm wie im Callcenter. Es gilt grundsätzlich bei allen Burnout-Erkrankungen: Die Krankenschwester ist gefährdeter als die Ärztin, weil die erste kaum Perspektive auf eine berufliche Entwicklung hat. Die Ärztin kann alles Mögliche machen. Entwicklungsmöglichkeiten schützen vor Depressionen.
Wie viele Patienten unterziehen sich einer Therapie wegen Depressionen?
Ich denke, das ist die häufigste Diagnose. Ängste und Depressionen.
Nach Corona wird die Diagnose nicht häufiger gestellt?
Das zu sagen wäre verfrüht. Es ist erwiesen, dass die Zahl der Psychotherapien wegen Depressionen und die Verordnung von Antidepressiva kontinuierlich ansteigen. Durch Corona wird sich der Trend nicht dramatisch verändern, sondern weiter steigen. Ich denke nicht, dass die Virusinfektion als solche irgendwie das Gehirn so angreift, dass die Depressionswahrscheinlichkeit ansteigt. Natürlich ist die Depressionsgefahr auch größer, wenn jemand körperlich krank ist. Jeden Tag eine halbe Stunde zu joggen ist ein unglaublich gutes Mittel gegen Depressionen. Wer sich eine Sehnenzerrung zuzieht und nicht mehr trainieren kann , wird vielleicht depressiv und kommt eventuell auch in Behandlung. Dann muss er versuchen, das Leben neu zu strukturieren.
In Folge der Spanischen Grippe trat noch ein Krankheitssymptom vermehrt auf: die europäische Schlafkrankheit. Sie wurde bis 1925 diagnostiziert, und die Leute waren tatsächlich antriebslos und haben viel geschlafen. In Tansania soll es sogar eine Hungersnot gegeben haben, weil die Leute es versäumt hatten, auf die Felder zu gehen. Könnte uns so etwas wegen Corona bevorstehen?
Die Ursache für diese Hungersnot ist wahrscheinlich ein Rätsel, das man nicht mehr aufklären kann. Augenblicklich gibt es ja eine umstrittene Erkrankung, das chronische Müdigkeitssyndrom, das auch mit Viren in Verbindung gebracht wird: Wenn jemand nach einem überstandenen Pfeifferschen Drüsenfieber 18 Stunden täglich schlafen möchte, und sein Studium, sein Leben verpasst. Heute sind die Ursachen für diese Erkrankung umstritten. Vor vierzig Jahren gab es darüber noch einen Konsens, da hat man das Müdigkeitssyndrom als psychogen erklärt.
Psychogen?
Seelisch bedingt. Man untersuchte die Leute, fand nichts, also mussten sie zum Therapeuten. Irgendwann ist das Virus nicht mehr aktiv, die Leute unterscheiden sich in ihrem organischen Zustand nicht von Leuten, die nicht müde sind. Ob es dann wirklich an der Psyche liegt, das weiß ja niemand so genau. Genauso wenig wie beim Beispiel der Hungersnot in Tansania, das eine Spätwirkung dieser Virusinfektion gewesen sein könnte oder vielleicht die Folge einer misslungenen psychosozialen Aufarbeitung. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Bauer seine Felder nicht bestellt, weil er sich müde fühlt. Das ist ja auch ein sehr selbstwirksamer Beruf. Da müsste man sich in die Sozialstruktur zu Zeiten des Kolonialismus vertiefen, um die Arbeitsbedingungen der Bauern genauer kennenzulernen. Die Psychiatrie ist ja auch ideologisch gefärbt. In den amerikanischen Südstaaten gab es eine Diagnose mit dem Namen Drapetomanie. Die wurde bei Sklaven gestellt, die davonlaufen wollten. Für die war der Psychiater zuständig. Im deutschen Konversationslexikon der Jahrhundertwende finden Sie diese Krankheit noch beschrieben. Heute würde man diese Drapetomanie als angemessene Reaktion auf Sklaverei ansehen.
Wieviele Formen von Depressionen unterscheiden Therapeuten?
Die Klassifikationen haben etwas Fliegenbeinzählerisches. In der Praxis unterscheidet man keine Formen, sondern behandelt den individuellen Kranken. Es gibt unterschiedliche Schweregrade. Die larvierte Depression, die sich in körperlichen Symptomen äußert, die leichte Depression, von der man auch als depressive Reaktion spricht, und dann die schwere Depression, die mit einer ausgeprägten Lähmung einhergehen kann. Wenn beispielsweise eine Patientin erzählt, dass sie sich zum Frühstück setzt und irgendwann guckt sie auf die Uhr und es ist mittag – das ist dann schon ziemlich heavy.
Können Depressionen ganze Gesellschaften befallen und in einem kollektiven Gedächtnis über längere Zeit wirksam bleiben?
Ich glaube da nicht dran. Alles, was psychologisch ist und mit kollektiv verbunden wird, ist meines Erachtens immer eine sehr problematische, eigentlich literarische Kategorie. Das kollektive Unbewusste von C.G. Jung ist etwas Poetisches, das kollektive Gedächtnis ist ein literaturwissenschaftliches Konzept. Naturwissenschaftlich würde ich sagen: Es gibt Menschen, die haben ihr Gedächtnis und es gibt soziale Strukturen und historische Ereignisse, die ihr Gedächtnis und Erleben prägen.
Sie glauben auch nicht an ein depressives Zeitalter nach der Spanischen Grippe?
Nein. Nach dem ersten Weltkrieg gab es einen Zivilisationsbruch, in dessen Folge viele Menschen depressiv geworden sind, weil er schwierig zu verarbeiten war. Auch weil davor eine manische Stimmung dominiert hat: In ein paar Monaten ist der Krieg vorbei und wir haben ihn gewonnen. Nach vier Jahren hat man gehungert, es gab viele Tote, die Individuen waren erschöpft und krankheitsanfällig. Ich weiß nicht, warum man für die Erklärung noch Begriffe wie die vom kollektiven Gedächtnis oder depressiven Zeitalter einführen sollte. Beide Begriffe sagen nicht viel.
Interview: Lars Reichhardt für SZ Magazin Online