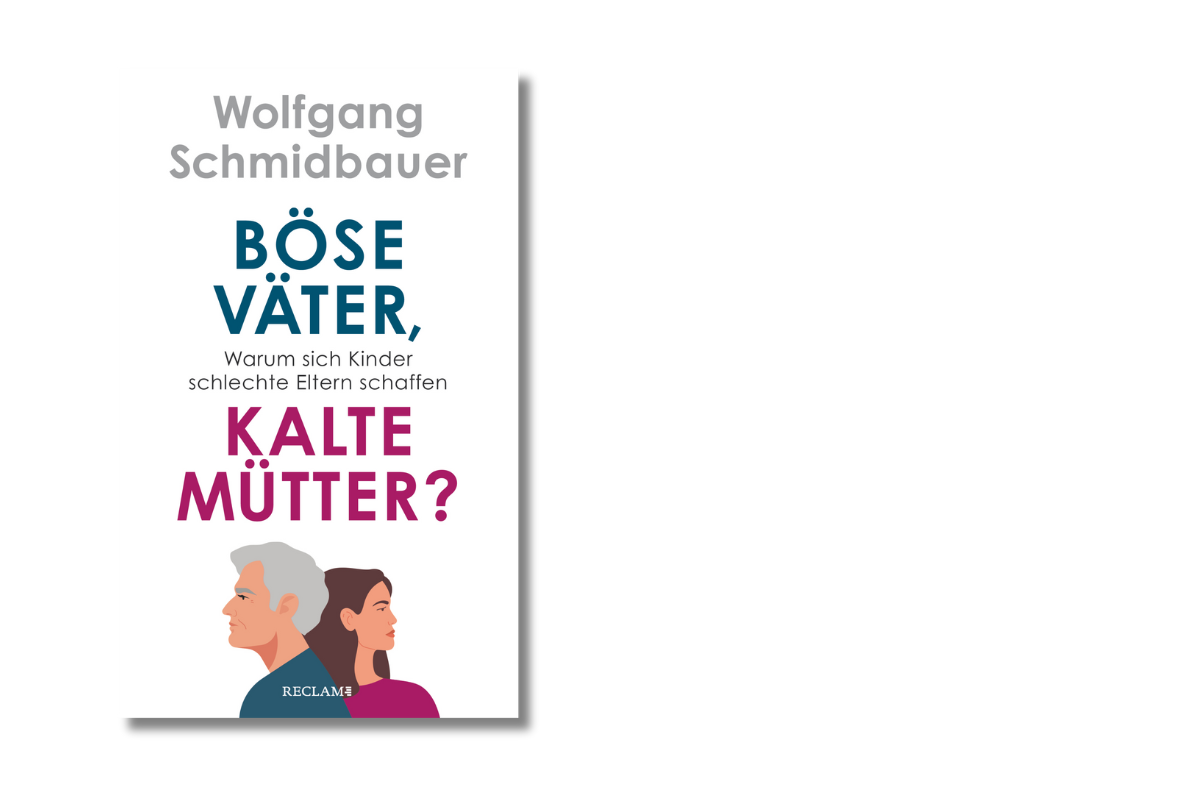Zusammenfassung: Die klassische Deutung sucht Unbewusstes in Bewusstes zu übersetzen. Sie riskiert, analytische Macht zu demonstrieren und kann Patienten dazu verführen, eine rationalisierende Abwehr neu zu strukturieren oder an einer Opferrolle festzuhalten. Verglichen damit ist das eher narrative Vorgehen, das C.G. Jung als Amplifikation beschrieben hat, wärmer und offener. Es regt an, selbst weiter zu forschen und sich von der Enge einer richtigen oder falschen Interpretation zu befreien.
Ich habe einige Patienten, mit denen ich gerne und nach gemeinsamem Urteil auch erfolgreich arbeite, aber nicht ganz umhin kann, mich gelegentlich zu fragen: Was machen wir da eigentlich?
Angesichts der Einladung, als Analytiker zu Jungianern zu sprechen, ist mir Jungs Begriff der Amplifikation eingefallen. Er scheint mir hilfreich, diese Frage zu beantworten, während meine Frage nach dem Eigentlichen damit zusammenhängt, dass in den Behandlungen, die mir in den Kopf kamen, eher selten gedeutet wird, wo doch die Deutung das therapeutische Werkzeug des Analytikers schlechthin ist. Aber es gibt auch keine Ratschläge oder Anleitung, bestimmte Dinge zu üben.
Das liegt zum Teil auch daran, dass diese Patienten schon älter sind und in ihrem Alltag eher anderen Rat und Hilfe anbieten. Die meisten sind erfolgreiche Fachärzte. Einige waren körperlich krank und medizinisch austherapiert; sie beschrieben eloquent ihre Symptome und das Versagen der bisherigen Versuche, ihnen zu helfen. Andere waren durch eine schwierige Ehe belastet. Sie versorgten mich mit Diagnosen über eine narzisstisch gestörte oder auf Borderline-Niveau funktionierende Partnerin, die sich trotz großer Bemühungen, sie zu mäßigen und die dramatischsten Folgen ihrer Störung abzupuffern, von ihnen trennen wolle. Es schien, als hätten sie zwei Wünsche, ohne recht daran zu glauben, dass diese realisierbar wären: von mir unterstützt der Partnerin einerseits zur Normalität zu verhelfen, anderseits zu verhindern, dass sie verloren ginge. Beide Wünsche standen einander im Weg, denn die Partnerin konnte die ständigen Versuche, sie zu kontrollieren und von oben herunter zu normalisieren nicht ertragen, zog sich also gerade vor dem engagierten Versuch zurück, sie näher und „besser“ zu binden.
Diese Patienten sprachen nicht nur viel, sie taten es auch in einer Weise, die mir die Rolle eines Zuhörers zuwies und nur selten eine Aktion ermöglichte, die ich klar mit der üblichen Rolle des Therapeuten verbinden konnte. Vor ein paar Tagen war einer von ihnen nach langer Pause wieder da. Er hätte mir sicher die anderthalb Stunden, die abgemacht waren, nur von dem Segeltörn erzählt, der ihn letztes Jahr drei Monate durch die Ostsee führte, wenn ich ihn nicht nach der Hälfte der Zeit unterbrochen und nach seinem behinderten Sohn gefragt hätte, der ihm große Sorgen macht.
Nach den ersten Sitzungen mit ihm, die inzwischen vielleicht zehn Jahre zurückliegen, forschte ich nach der Bedeutung des lateinischen Wortes Suada, das mir spontan eingefallen war. Suada heißt Redefluss und geht auf eine römische Göttin der Beredsamkeit zurück, die auf sanfte Weise dominiert, indem sie Einwände nicht laut werden lässt. Er führte eine große Praxis in einer anderthalb Fahrstunden entfernten Stadt und konnte nur alle 14 Tage kommen. Aber die Stunden schienen ihm zu helfen, obwohl ich nicht wusste, wodurch, denn er redete fast die ganze Zeit, sprach über Musik, Kunst, seine Kollegen in einen MVZ, die ihn ausnützten, über Frauen, die ihn einengten, über seinen Sohn, den er zuerst nicht wollte und dann doch, und obwohl die Beziehung zur Mutter schnell gescheitert war, als das Beste pries, das ihm jemals passiert sei. Ich sah keinen Weg, Widerstands- oder Übertragungsdeutungen anzubringen, ließ mich belehren, und begann eigene Erzählungen und Beobachtungen einzuflechten.
Es ist unvermeidlich, dass der Analytiker von solchen Patienten sehr ambivalent erlebt wird, droht er doch die Helfer-Rolle in Frage zu stellen, deren fiktive Sicherheit – abhängig sind immer die anderen – ein wesentlicher Bestandteil der manischen Abwehr ist, die zu Beginn solcher Behandlungen im Vordergrund steht.
Das führt dazu, dass diese Patienten zwar sichtlich leiden, aber kaum zu bewegen sind, über ihr als Schwäche und Versagen erlebtes Leid zu sprechen. Statt dessen versuchen sie, mit dem Therapeuten zu plaudern, fragen ihn nach seinem Beruf und wie er beispielsweise das Medizinsystem oder die aktuelle Politik beurteilt, berichten von einem tollen Konzert oder einem abenteuerlichen Urlaub, erzählen Erfolgsgeschichten.
Was mir in dieser schwierigen Situation wohl geholfen hat, ist meine eigene ironische Distanz zu meiner Rolle als Helfer, die darin wurzelt, dass ich mich als Schriftsteller verstehe, der auch Analytiker ist. Es machte mir also weniger Probleme als vielen Kollegen, die ich in Intervisionen über solche Patienten seufzen hörte, mir erst einmal die Helferrolle weitgehend wegnehmen zu lassen und zuzusehen, wie diese zugleich starken und empfindlichen Männer ihren inneren Zustand vor mir ausbreiteten.
Ich hörte ihnen zu und lernte im Lauf der Jahre immer besser, eine Rolle zu ertragen, in der ich nur ausnahmsweise mein therapeutisch- deutendes Handwerkszeug zur Hand nehmen durfte, während die andere Zeit dazu diente, mit dem Patienten zu plaudern, an seinem Leben und an seinen Urteilen über sich selbst und andere Personen teilzunehmen, gelegentlich einen eigenen, ergänzenden, zum Narrativ des Patienten passenden Einfall beizusteuern, immer wieder auch Anerkennung für die Ideen und die Lebensleistung der Patienten einzuflechten und geduldig auf die Gelegenheit zu warten, mich mit einem therapeutischen Gedanken einzumischen.
Manchmal bin ich bei Kollegen und auch bei Supervisanden einer abschätzigen Haltung gegenüber diesem Plaudern mit Patienten begegnet. Sie verstanden nicht, warum ich mich nicht über solche Manöver ärgere, die doch meine Entfaltung als Therapeut behindern, und mochten nicht glauben, dass ich das Zusammensein mit Patienten, die ihren Narzissmus so entfalten, durchaus genieße und mit ihnen über die in solchem Kontext möglichen Scherze lache. In der Tat widerspricht etwas, was man durchaus als gemeinsamen Genuss eines Widerstandes ansehen könnte, auch Greensons Standardwerk über Technik und Praxis der Psychoanalyse. Dort steht:
„Im großen Ganzen ist die analytische Arbeit ernst. Sie ist vielleicht nicht immer abscheulich oder elend, und nicht jede Stunde ist deprimierend oder schmerzlich, aber im allgemeinen ist sie, um das mindeste zu sagen, von harter Arbeit erfüllt.“[1]
Nun, in der Tat ist Therapie Arbeit, man verabredet sich für eine bestimmte Zeit, muss pünktlich kommen, verlässlich bleiben und verbringt diese in gegenseitiger Aufmerksamkeit. Aber die Adjektive „ernst“ und „hart“ stelle ich in Frage, denn es geht im Kern um Freiheit, um Kreativität und Phantasie. Einer der erwähnten Patienten arbeitete als Chefarzt; seine leitende Assistentin hatte ebenfalls eine Analyse absolviert und wunderte sich laut, dass er so entspannt aus den Sitzungen mit mir käme, denn sie sei nach ihren Stunden oft völlig fertig gewesen, weil die Therapeutin sie habe hängen lassen und keine ihrer Fragen beantwortete. Mein Patient erklärte, das habe er bei mir noch nie erlebt, sein Therapeut würde mit ihm ein ganz normales Gespräch führen, jeder steuere etwas bei.
Als er mir davon erzählte, sagte er sinngemäß: Sie hat angedeutet, dass das bei Ihnen keine richtige Analyse ist, aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie so mit mir umgehen würden wie es M. erzählt, wäre ich keine Stunde geblieben.
Kann es sein, dass manche Analytiker die Bibel zu ernst nehmen, in der harte, ernste Arbeit die Strafe für den Verlust des Paradieses ist? Wer da nicht Dornen und Disteln jätet im Schweiße seines Angesichts, kann kein guter Analytiker sein?
Ich finde, als Autor wie als Analytiker, dass Arbeit am besten dann gelingt, wenn sie nicht hart und ernst ist, sondern selbstvergessen der eigenen Inspiration gehorcht. Ich fühle Freud auf meiner Seite, dessen Behandlungszimmer mit seinen ehrwürdigen Spielzeugen angefüllt war und dessen Deutungen oft die schönsten Amplifikationen enthielten, etwa als er die amerikanische Dichterin Hilda Doolittle mit seiner Bronzestatuette von Pallas Athene tröstete: Sie ist wunderschön, aber sie hat ihren Speer verloren.
Man wird dem plaudernden Analytiker unterstellen, dass er es sich leicht macht und vor dem Widerstand des Patienten zurückweicht, den dessen manische Abwehr aufrichtet. Ich sage dann manchmal ironisch, dass die schlechteste Intervention, die den therapeutischen Prozess aufrecht erhält, doch besser ist als die beste, welche ihn unterbricht. Aber kann ich den Verdacht entkräften, dass in diesen vorwiegend plaudernd verbrachten Sitzungen überhaupt ein therapeutischer Prozess stattfindet? In den beschriebenen Behandlungen habe ich eine wachsende Stabilisierung, das Zurücktreten von Depressionen und eine insgesamt bessere Lebensbewältigung beobachtet. Zudem schätze ich die Patienten durchaus so ein, dass sie ihre Zeit und manchmal auch ihr Geld nicht mehr opfern, wenn sie nicht von der Behandlung profitieren.
Wie gut sind nun aber meine Gründe, solche Behandlungen als Argument für den Wert der Amplifikation gegenüber dem der Deutung einzuführen?
Amplifikation und Interpretation sind in ihren ursprünglichen Bedeutungen „Vermehrung“ gegenüber „Deutung, Übersetzung“. Was es heißt, einen Text aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen, ist leicht zu verstehen: Je tüchtiger der Philologe dabei vorgeht, desto genauer werden sich Sinn und Form des Originals in der Übersetzung wiederfinden lassen. Aber die Deutung? Hier müssen wir weiter ausholen.
Nach einer griechischen Anekdote biss Alkibiades, als er in einem Ringkampf zu unterliegen drohte, seinen Gegner so kräftig, dass dieser losließ und schrie: „Du kämpfst wie ein Weib!“ „Nein, wie ein Löwe“, entgegnete Alkibiades.
Seine Antwort belegt eine elementare Form von Deutung. Durch einen zweiten Begriff, der zu einem ersten in ein Spannungsverhältnis tritt, wird eine Situation neu bewertet. Der Löwe ist ein starkes, königliches Tier, dem man nicht unterstellen kann, dass er aus Not zu unfairen Mitteln greift. Zu beißen, ist seine Natur, ein Ausdruck seiner Macht. Indem sich Alkibiades mit dem Löwen vergleicht, macht er aus seinem Notbehelf eine Stärke und besiegt den Gegner durch eine neue Form oraler Aggression – Schlagfertigkeit mit Worten – ein zweites Mal. Die von ihm gegebene Deutung seiner Tat setzt diese mit anderen Mitteln fort. Wir erkennen in diesem Handeln wie in dem von Alkibades gefundenen Vergleich etwas Drittes: schrankenlosen Ehrgeiz, heftige Angst, nicht zu siegen, Wahllosigkeit der Mittel, wenn er in Bedrängnis ist, Schlagfertigkeit und Kampfgeist. Wenn wir so argumentieren, haben wir Alkibiades‘ Deutung, wie ein Löwe, nicht wie ein Weib zu beißen, noch einmal gedeutet.
Deutungen hängen also mit einem Widerspruch zusammen: Alkibiades widerspricht seinem Gegner, und wir müssten vielleicht Alkibiades widersprechen, der unsere Deutung seiner Rücksichtslosigkeit und seines Ehrgeizes vielleicht ablehnen würde: was da aus seiner unschuldigen Bemerkung gemacht wird! Deutungen finden sich an Grenzen zwischen semantischen Feldern; sie versuchen, das zu erfassen, was sich in einem anderen Feld bewegt, aber ohne den Deutungskunstgriff nicht genügend gut eingeordnet werden kann.
„Einen Traum deuten heißt, seinen Sinn angeben, ihn durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertiges Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt“, sagt Freud in der „Traumdeutung“. Alkibiades kann nicht einordnen, dass er ein Weib sein soll, denn er bewegt sich in einem sozialen Feld, wo Weiber verächtlicher sind als Männer, wenn es um Kampf geht. In diesem Feld ist Aggression den Männern vorbehalten. Frauen werden geschmäht, wenn sie sich mit körperlicher Gewalt durchsetzen, sie stehen für mangelnde Fairness.
Aus diesem Gründen ist es auch unmöglich, bei zwei konkurrierenden Deutungen – beißt Alkibiades wie ein Weib oder wie ein Löwe? – eine Entscheidung zu treffen, welche nun gilt. Das unterscheidet Deutungen von Übersetzungen.
Alkibiades bricht aus dem semantischen Kontext der Ringkampfregeln aus. Dadurch entsteht eine ungeordnete Situation; da kein Kampfgericht vorhanden ist, das den Regelverstoß ahndet, müssen die Kontrahenten selbst versuchen, seine Tat einzuordnen. Dabei wird erkennbar, dass der semantische Kontext feldabhängig ist: im Wahrnehmungsfeld des Gegners wirken andere Kräfte als im Wahrnehmungsfeld von Alkibiades. Diese Merkmale lassen sich sehr häufig nachweisen, wenn gedeutet wird.
In der Antike berichteten Reisende, die an fremden Küsten landeten, die dortigen Bewohner würden – ein Beispiel – zu Artemis und Herakles beten, diese Gottheiten aber mit fremdartigen, nur ihnen eigentümlichen Namen benennen. Ein Missionar monotheistischer – christlicher oder islamischer – Prägung würde in den fremden Numina nur Götzen, Inkarnationen des Satans erkennen. Er lebt in einem anderen semantischen Feld als der polytheistisch erzogene Römer oder Hellene.
So gesehen, rufen alle Spuren alter Religionen, die unter einem neuen Glauben fortbestehen, nach Deutungen, denn es ist eine Spannung zwischen dem alten Glauben und der gegenwärtigen Situation entstanden. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass durch den zweizeitigen Ansatz der menschlichen Sexualentwicklung mit Frühphase und Latenz kindliche Leidenschaften in einem anderen semantischen Feld angesiedelt sind als das, was der Erwachsene erlebt. Die Deutung rekonstruiert, wie die Kindheit im Unbewußten fortwirkt, um Symptome Erwachsener zu verstehen und so einen Neuanfang, eine Nachreifung der Persönlichkeit zu ermöglichen.
Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde ein Teil der Psychologen immer stärker durch Maß und Zahl fasziniert und strebte die Quantifizierung hochspezialisierter Fragestellungen mit häufig geringer praktischer Relevanz an. Andere – ihr Pionier ist Freud – entdeckten die Vor-Geschichte der historischen Überlieferung, den Mythos. Individuelle Beobachtungen, wie die erotische Vaterbindung einer hysterischen Patientin, wurden mit einem Begriff wie „Ödipus-Komplex“ zu einem mythologischen Thema gemacht.
Der Mythos ist eine Urgeschichte, eine Erzählung, die zunächst dazu dient, etwas zu erklären – einen Ortsnamen, einen Brauch, eine Abstammung. In dieser Erklärung drückt sich sehr häufig auch eine Freude an der poetischen Darstellung existenzieller Grundprobleme aus. Um diese poetische Darstellung der menschlichen Existenz ging es auch den praktisch-klinischen Richtungen der Psychologie. Von einem Arzt begründet und von Ärzten einerseits, Geisteswissenschaftlern anderseits viel gründlicher aufgenommen als von der akademischen Psychologie, hing und hängt dieser psychologischen Richtung die mangelnde Klarheit über denen eigenen wissenschaftlichen Standort nach.
Einerseits zwingt die ärztliche Tätigkeit in der dauernden Begegnung mit unsicheren, leidenden, in ihrem Lebenswillen verletzten Menschen den Helfer zu einem hohen Maß an Festigkeit und Sicherheit, die er immer aus dem größten Prestige nimmt, das ihm seine Zeit zur Verfügung stellt. Das war seit 1900 bis heute die exakte Naturwissenschaft, die den Ärzten ein sicheres Fundament auf Physik und Chemie, Anatomie und Pathophysiologie versprach. Diese Methode glaubte Freud noch anzuwenden, als er sich längst in einer genialen Regressionsbewegung im Bereich des Mythos bewegte. Warum sollte er auch anders denken? Er zeichnete Beobachtungen auf, und wertete sie aus. Wenn ihm sein Sprachverständnis das Mikroskop, seine Notizen die Fotografie, seine Deutung die mathematische Auswertung oder die anatomische Darstellung ersetzten, lag es für ihn gewiss nicht daran, dass er weniger ernsthaft um die Deutung seiner Träume bemüht war als um die Funktionen der Organe des Aals, welchen er in seiner medizinischen Dissertation untersucht hatte. Aber ohne die mathematische Kontrolle und ohne die Möglichkeit, ein anatomisches Substrat, eine Struktur unter den beobachteten Erlebnissen festzuhalten, wurde bald klar, dass es nicht eine einzige richtige Deutung gab, sondern eine viel größere Anzahl, eine potentiell unendlich große Deutungsmenge.
So berührt die psychoanalytische Wahrheitsfindung die künstlerischen Lösungsmöglichkeiten: Angesichts einer strukturell umgrenzten Aufgabe – zum Beispiel eine Madonna mit dem Jesusknaben zu malen – gibt es doch eine unerschöpfliche Menge von Lösungen, wie dieses Bild gestaltet werden soll. Immer werden eine Frau und ein Kind darauf zu sehen sein, doch wie sie sich zueinander verhalten, was sie durch ihre Kleidung, ihre Körperhaltung und Mimik ausdrücken, das lässt unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung zu, und jede dieser Gestaltungen kann noch einmal von unterschiedlicher Qualität sein.
Freuds Konzept einer Analogie zwischen der mehrfachen Determination in der Entstehung seelischer Phänomene – etwa eines Traums – und der „Überdeutung“, d.h. der Ansammlung einander ergänzender, lediglich auf den ersten Blick vielleicht widerspruchsvoller Deutungen ist ein Versuch, aus diesem Dilemma zu entrinnen. Die Determination des Seelischen reicht in eine unergründliche Tiefe, der eine unendliche Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten entspricht. Aber es erscheint mir plausibel, davon auszugehen, dass ein Traum oder ein Symptom tatsächlich auf einer endlichen Menge von Bedingungen beruhen, während die Zahl der möglichen Deutungen dieses Traumes oder dieses Symptoms unendlich ist.
Diese verwickelte Situation hängt damit zusammen, dass das Gedeutete eines ist – ein Mensch, ein Ausschnitt aus der Lebensgeschichte dieses Menschen, eine bestimmte biographische Entscheidung, ein Traum, ein Symptom – während die Deuter potentiell unendlich viele sind; einer nach dem anderen kann die gedeutete Szene aufgreifen und eine bisher noch nicht entdeckte Bedeutung entdecken. Solche Prozesse sind in der Psychoanalyse durchaus abgelaufen; beispielsweise wurden Breuers und Freuds Krankengeschichten mehrfach neu interpretiert und aus Anna O. eine Psychose-Patientin gemacht, die Breuers Ich-Identität attackierte, oder aus Emmy von N. ein Borderline-Fall.
Die analytische Deutung ist eng mit einem zentralen Element der menschlichen Existenz verbunden: der Sehnsucht nach Wahrheit. Diese Sehnsucht ist in vielen Fällen unerfüllbar, aber auch in diesen ist, wie es die Denker aller Zeiten betont haben, eine Bewegung möglich: etwas weniger Dunkelheit, etwas mehr Licht. Jede einzelne Deutung strebt danach, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Ob ihr das gelingt und sie nicht in Wahrheit sich davon wieder weiter entfernt, das ist die zentrale wissenschaftliche Frage, unter der die primär künstlerisch entworfene Deutung geprüft werden muss.
Jede vom Patienten angenommene Deutung ist auch eine Amplifikation in dem Sinn, dass sie sein Erleben bereichert. Allerdings dürfen wir nicht übersehen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der Wettbewerb um und Neid auf die Rolle des durch Wissen Überlegenen früh vermittelt und nachhaltig verstärkt werden. „Ich weiß es besser“ ist ein Triumphgefühl, das in zwölf Schuljahren aufgebaut wird und im Repertoire des beruflich erfolgreichen Professionellen einen wichtigen Platz einnimmt.
Wie mühevoll und kränkend für die Beteiligten die fehlende Distanz zur besserwisserischen Qualität von Deutungen werden kann, zeigt ein Buch der Autorin (und Ausbildungskandidatin) Dörte von Drigalski: Blumen auf Granit. Eine Irr- und Lehrfahrt durch die deutsche Psychoanalyse.[2]
Wenn ein Patient die erwähnte manische Abwehr in die Therapie mitbringt, wird er erst einmal große Mühe haben, ein anderes Verständnis seiner Probleme als das eigene zuzulassen, denn wer soll sie besser verstehen als er, dem sie am wichtigsten sind und der über die meisten Informationen verfügt? Anschaulich war für mich in diesem Punkt eine meiner ersten Analysen. Mein Patient war ein schwer depressiver Gymnasiallehrer, der nach einer gescheiterten Ehe mit Suizidgedanken Hilfe suchte. Anfangs hatte ich große Schwierigkeiten, weil er immer wieder in einen Redeschwall verfiel, in dem er sich selbst glorifizierte und ohne Punkt und Komma berichtete, was er alles besser gemacht habe als andere.
In der Supervision entdeckten wir, dass das geschah, wenn er sich durch eine Deutung in Frage gestellt fühlte. Allmählich lernte ich, mich in seiner so hoch kränkbaren inneren Welt zurecht zu finden und entsprechen vorsichtig alle Begriffe zu meiden, die er als Schwäche, Fehler, Makel auffassen hätte können.
Nach zwei Jahren einer Analyse, in der wir seine zwanghafte Abwehr und die biographischen Hintergründe seiner panischen Angst untersuchten, verlassen zu werden, sagte er in der letzten Stunde sinngemäß: Es geht mir besser, vielen Dank, aber etwas wirklich Neues habe ich in der Analyse nicht erfahren. Das bedeutete: Wenn es etwas Neues über mich zu entdecken gibt, bin ich auf jeden Fall der erste, der es findet.
Ich wusste damals noch etwas weniger über Narzissmus als heute und war dementsprechend etwas mehr gekränkt, habe aber dem Oberstudienrat – das war er wirklich – gerne verziehen, denn er hat mir doch eine sprechende Geschichte hinterlassen. Vielleicht hatte er auch etwas von meinem therapeutischen Ehrgeiz mitbekommen und darauf reagiert.
Nach Abschluss meiner Ausbildung lernte ich anlässlich seines Besuchs in München Heinz Kohut kennen. Ich erzählte ihm von meinen Forschungen[3] über den Ausdruck von Größenphantasien, Spaltungen und narzisstischen Dramen von Erhöhung und Erniedrigung in Heldensagen und trivialen Romanen. In Erinnerung geblieben ist mir seine Begeisterung für den Narzissmus als schöpferische Kraft, eine sozusagen aktive Anerkennung, die ich heute in Kontrast zu der eher defensiven Haltung der Supervisorin meines ersten Patienten sehe. Sie half mir zwar, die narzisstischen Widerstände des Patienten zu verstehen, vermittelte mir aber nicht, dass narzisstische Phantasien interessant sind und es durchaus möglich ist, ihnen mit Wohlwollen und Humor zu begegnen.
Sicher setzt sich meine gegenwärtige Haltung im Umgang mit narzisstisch belasteten Patienten aus mehr Komponenten zusammen als aus den drei hier erwähnten: der Supervision meines ersten Patienten, der Bewunderung für Heinz Kohut und meiner Forschung über die Helden der trivialen Literatur, aber diese drei scheinen mir die prägnantesten. Sie haben dazu geführt, dass ich, wenn ich mich mit den Mitgliedern meiner Intervisionsgruppe vergleiche, länger neugierig bleibe, wie solche Störungen aufgebaut sind und warum die Menschen, die unter ihnen leiden, so wenig dagegen tun können, Äste abzusägen, auf denen sie doch gerne Halt fänden.
Die Patienten, von denen ich anfangs gesprochen habe, würden die Therapie verlassen, wenn ein Analytiker ihnen ihre manische Abwehr als Widerstand deutet. Und doch können sie im Lauf der wertschätzenden Gespräche – was ein vornehmerer Ausdruck für Plaudern ist – sich dem Gedanken nähern, dass ihr eigenes Verhalten zu ihren Problemen beiträgt. Wenn sie gelegentlich, unaufgefordert, auch Geschichten über ihre Kindheit und Jugend, über Spannungen mit Geschwistern und Eltern erzählt haben, trägt das dazu bei, dass sie mehr Abstand gewinnen. Ein Beispiel:
Der 62jährige ist hochbegabt. Er spielt mehrere Instrumente und tritt mit Berufsmusikern auf, spricht perfekt die Sprache seiner Partnerin, die er im Ausland kennen gelernt hat. Er arbeitete lange erfolgreich und erkrankte an einem Autoimmunleiden, das ihn vor zehn Jahren in eine niederfrequente analytische Therapie führte. Die Stunden verlaufen fast immer so, dass er in einem Redeschwall, unterbrochen von stoßweisem Gelächter und ganz ohne Zeichen von Angst, Trauer oder Schmerz über seine Symptome, die problematische Geschichte seiner Eltern, die Unzulänglichkeiten der Krankenversorgung, die Ausübung professioneller und semiprofessioneller Musik, seine Sammlung von Musikinstrumenten, die sozialen Probleme im Herkunftsland seiner Frau und ähnliche Themen spricht. Wenn mir etwas zu seiner Erzählung einfällt, trage ich zu ihr bei, meistens weiß ich weniger als er und lasse mich belehren.
Manchmal ergeben sich kleine Diskussionen. Ich erinnere mich an eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich des Übens in der Musik und des Trainings im Sport. Er vertrat die Überzeugung, dass man nur weiterkommt, wenn man Schmerzgrenzen überschreitet; ich sagte, das Wichtigste sei doch die Freude am Üben und dass man umso lieber übe, je besser man die Tätigkeit beherrsche. Ich glaube nicht, dass ich ihn überzeugen konnte.
Einen Konflikt gab es, als ich zu explizit die psychosomatische Komponente in seiner Erkrankung betonte. Er fühlte sich nicht ernst genommen und schrieb mir eine lange mail mit Quellenangaben, wie hilflos behindert Kranke bei einem ungünstigen Verlauf dieses Leidens seien. Als ich mein Bedauern über meine Äußerung ausdrückte, schien er nichts davon wissen zu wollen und kehrte zu dem vertrauten Muster der Stunden zurück. Anfangs zahlte seine private Krankenkasse; inzwischen vereinbaren wir eine Sitzung pro Monat, auf die er Wert legt. In den Jahren der Zusammenarbeit ist die Grunderkrankung nicht fortgeschritten. Ich zögere, die Therapie als einen Faktor zu beurteilen, der das begünstigt hat, aber ich fürchte doch, dass es riskant sein könnte, die Behandlung zu beenden.
In der letzten Sitzung hatte ich den Eindruck, sozusagen mehr Therapie als sonst gemacht zu haben. Der Patient schilderte Beziehungsprobleme seines Sohnes, der zwei Tage lang geweint habe, und drückte seinen Respekt davor aus, dass dieser eine Entscheidung getroffen habe und jetzt mit einer Frau zusammen sei, die ihn besser behandle. Ich sagte, es sei doch ein großes Kompliment, dass der Sohn mit ihm gesprochen und sich unterstützen habe lassen. Dann wechselte der Patient zu den Weihnachtstagen und dem Besuch seines älteren Bruders, zu dem er keinen Kontakt gefunden habe. Seine beiden Geschwister und die verwitwete Mutter hätten auf eine für ihn kaum erträgliche Weise alles geleugnet, was irgendwie nach Problemen aussah, und sich selbst glorifiziert. Er habe das kaum ausgehalten, aber auch nicht gewusst, was er dagegen tun könne.
Ich sagte, es sei vielleicht wie beim Bordorchester der Titanic. Womöglich könne man nicht mehr tun, als der Musik zuzuhören und zu bewundern, wie tapfer die Musiker angesichts der Gefahr weitermachen. Er lachte und sagte dann: früher war ich genau so, die ganze Zeit. Wir verabredeten uns zur gewohnten Zeit in vier Wochen. „Sehr gerne!“ sagte er und ging.
An dem Begriff der Amplifikation gefällt mir, dass es darum geht, etwas zu vermehren. Das ist an sich nichts Besonderes. Menschen sind soziale Tiere und finden eine animalische Befriedigung darin, nicht allein zu sein. Kinder und Hunde laufen gewöhnlich aufeinander zu, wenn sie im freien Feld ihresgleichen begegnen. Erwachsene sind komplizierter, parallel zur Differenzierung ihrer Kultur, denn in einer von sozialen Unterschieden geprägten Welt sind Begegnungen nicht mehr naiv in dem Sinn, dass man aufeinander zuläuft und sich beschnuppert, sondern Vorstellungen abarbeitet, wie viel Nähe für beide Seiten zuträglich ist.
Auch in der therapeutischen Situation funktioniert diese grundsätzliche Bereicherung. Man könnte zugespitzt sagen: die Amplifikation geht der Übertragung voraus, das Gefühl, gut für einander zu sein, sich wechselseitig bereichern zu können, schafft die Grundlage für das Arbeitsbündnis. Bei narzisstisch belasteten Menschen, die gewöhnt sind, als Arzt, Lehrer, Manager respektiert zu werden und ihre soziale Umwelt zu kontrollieren, kann die klassische Deutung der manischen Abwehr als Widerstand nicht funktionieren. Es geht dann darum, dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Wenn ich die Unterscheidung von kaltem und warmem Denken[4] hier einführe: die Deutung eines Widerstandes nähert sich dem kalten Pol, der Analytiker beansprucht hier ein Wissen, das der Patient noch nicht hat, was sich in Gegensatz zu dem Bedürfnis des narzisstisch deprivierten Patienten setzt, die privilegierte Rolle des Besserwissers zu behalten.
Auch der Funke im Auge der Mutter, von dem Kohut sprach, ist etwas wie ein Spiegel, aber doch ein anderer, als ihn Freuds Metaphern vom „wohlgeschliffenen Spiegel“ und vom Chirurgen ankündigen. Wir wissen aus vielen Berichten, dass Freuds Praxis sehr viel reichhaltiger war. Stabile Beziehungen beruhen auf Austausch und positiven Regelkreisen. Der Erfolg einer Therapie gleich welcher Schulrichtung hängt nach vielen Studien an der vom Patienten erlebten, „guten Beziehung“ zum Therapeuten. Jede gute Beziehung beruht darauf, dass nicht einer den vollen Topf und der andere den Löffel mitbringt, sondern beide geben wie nehmen.
Ich denke, dass der Begriff der Amplifikation auch hilft, die vielfach unterschätzte „stützende Therapie“ differenzierter zu sehen und auch ernster zu nehmen. Ein intellektuell anspruchsvoller Patient verliert rasch das Interesse, wenn er mit durchschaubaren Techniken traktiert wird. In Jungs Auffassung dient die Amplifikation vor allem dazu, durch Beiträge des in Mythologie, Geschichte und Anthropologie bewanderten Analytikers in Träumen und Phantasien angedeutete archetypische Gestalten und Situationen zu ergänzen und zu vervollständigen.
In diesem Sinn ist auch der schon erwähnte, von Hilda Doolittle zitierte Satz Freuds zu seiner Patientin über seine Statue der Pallas Athene eine Amplifikation: Sie ist vollkommen, aber sie hat ihren Speer verloren. Das ist doch eine ganz andere Intervention als etwa den Penisneid zu deuten. In der Tat ist das Bild der Jungfrau, die in voller Rüstung, weiser und geschickter als Männer und Götter, dem Haupt des Vaters entsteigt, nicht nur aufbauender, sondern auch vollständiger im Hinblick auf die narzisstische Problematik einer Hochbegabten.
In meiner Dissertation über Mythos und Psychologie[5], in der ich die psychologische Mythendeutung am Beispiel des Ödipusmythos darstellte, habe ich mich sehr kritisch mit dem Archetypus-Begriff auseinandergesetzt. Er sei voller Widersprüche und mäandere zwischen Biologie und Spiritualität. Inzwischen bin ich viel milder geworden, denn zweifellos lassen sich mit diesem Begriff sozusagen hilfreiche Szenen schaffen, welche narzisstisch belastete Patienten aus ihrer Isolation befreien und sie geistig mit dem Menschlichen allgemein verbinden, dessen tragische Qualitäten zu verleugnen doch weit anstrengender ist als sie zu akzeptieren. Der Gedanke, dass Menschen untereinander verbunden sind und vieles Gemeinsame in ihrer Geschichte und in den Mythen und Märchen teilen, die sie sich erzählen, braucht gar kein systematisch aufgefasstes Untergeschoss im Unbewussten. Die von mir hier aufgegriffene Gruppe von Patienten kann auf jeden Fall erzählende Interventionen weit besser verarbeiten als deutende. Die Erzählung stellt Sprecher und Zuhörer auf eine Stufe, während die Deutung impliziert, dass einer zwei Sprachen kennt, der andere aber nur eine. Aus Jung’scher Sicht arbeite ich gegenwärtig, wenn ich gerade in Paaranalysen den Unterschied zwischen der animalischen und der narzisstischen Liebe[6] herausarbeite, mit dem Archetypus des Tieres.
Im Zen-Buddhismus wird folgende Geschichte in unterschiedlichen Variationen erzählt. Ein angesehener Mönch antwortet auf die Frage nach seinem erleuchteten Zustand: Ich esse, wenn ich hungrig bin, und ich schlafe, wenn ich müde bin. Die Schüler wundern sich – tun wir das denn nicht alle? Der Weise antwortet, dass die meisten Menschen niemals ganz und gar in dem aufgehen, was sie gerade tun, sondern sich zusätzlich noch mit Ursachen und Folgen beschäftigen, die sie verwirren. Der Therapeut wird das bestätigen – viele Menschen zählen Kalorien und fürchten sich vor ihrem Hunger; andere schlafen nicht, wenn sie müde sind, weil sie unbedingt noch etwas erledigen müssen, und liegen nachts wach, weil sie sich Sorgen machen. Indes liegt der Hund auf seiner Decke; seine Praxis gleicht der des erleuchteten Meisters, wer bewundert ihn dafür?
Hier noch eine therapeutische Szene mit einer Amplifikation: Die Analysandin, eine 50jährige Akademikerin, hat mit einem langjährigen Freund einen schönen Abend entworfen: Gemeinsam kochen, bei Kerzenlicht essen, Gespräche, je nach Stimmung auch Sex. Es ist seine Küche, er ist stolz auf sein Gerät und faucht sie an, als sie mit dem Messer ein Stück Gemüse in der Pfanne zerkleinert, pass doch auf, die Beschichtung geht kaputt. „Er hat mich so aggressiv angeschaut, hat richtig gefunkelt, ich hab ihm doch nichts getan, die Stimmung war verdorben, ich hatte wenig Appetit, hab mich so durch den Abend geschleppt, er war dann wieder ganz lieb, ich wollte aber nicht bleiben, er hat mir noch angeboten, mir die Reste des Auflaufs einzupacken. Aber ich glaube, es wird nichts mit uns, er ist einfach nicht der Richtige.“
„In solchen Konflikten“, sage ich hinter der Couch, „gibt es eine animalische und eine romantische oder narzisstische Lösung.“
„Und die wären?“
„Animalisch ist es, sich anzuknurren und sich dann wieder zu vertragen, als ob nichts gewesen wäre. Narzisstisch ist es, den Konflikt festzuhalten und nach einer Möglichkeit zu suchen, dass er sich niemals wiederholt. Das wäre dann das romantische Ideal.“
„Dann suche ich doch eher nach der narzisstischen Lösung.“
Zu meinem Umgang mit narzisstisch belasteten Patienten gehört, dass ich Fragen nicht analysiere, sondern beantworte. Leitlinie ist der Gedanke, für die Patienten möglichst durchschaubar in dem Sinn zu sein, dass nichts passieren wird, was sie in Frage stellt und das prekäre Gleichgewicht von Angst vor Beschämung und Größenphantasie erschüttern würde. Erst dann versuche ich, den Hintergrund der Frage zu verstehen. Wo immer es geht, ersetze ich normative Gesichtspunkte durch ökonomische und stelle so auch von selbstschädigendem Stolz oder panischer Verlustangst getragene Entscheidungen zur Debatte.
Beispiel: Einer dieser Patienten konnte nicht ertragen, dass eine Frau, die er schon oft vor den Kopf gestoßen und mit wütenden Entwertungen weggeschickt, aber immer wieder auch vermisst und zurückerobert hatte, schließlich entnervt mit einem anderen Mann in einen Urlaub ans Mittelmeer gereist war. Er setzte sich in sein schnelles Auto, stritt sich nach einer Fahrt von beinahe tausend Kilometern heftig mit ihr, schickte sie zum Teufel und fuhr wieder zurück. Ich sprach anerkennend von diesem Einsatz für eine Beziehung, freute mich mit ihm, dass er in seinem aufgewühlten Zustand keinen Unfall verursacht hatte und stellte nur die Frage, ob das Ergebnis den Einsatz von so viel Treibstoff und Nervenkraft lohne.
Stolz, pflege ich zu sagen, ist erhaben, aber unpraktisch. Stellen wir uns vor, in meinem Dorf gibt es nur einen einzigen Laden, ich werde dort beleidigt und schwöre, nie wieder einen Fuß hinein zu setzen. Also fahre ich zehn Kilometer in das nächste Dorf, wo der Laden bestimmt nicht besser ist. Was ist jetzt vernünftiger: den Kränkungsschwur einzuhalten, oder wieder im Ort einzukaufen und so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre?
Eine Voraussetzung, um die hier beschriebenen Patienten behandeln zu können, ist eine gewisse Gutartigkeit des Narzissmus, die sich vor allem darin ausdrückt, dass die Patienten korrekt mit dem Rahmen umgehen. Das Risiko der Entgleisung in narzisstischen Kannibalismus kann so überschaubar bleiben. Mit diesem Begriff meine ich die Tendenz, sich selbst durch die Entwertung eben der Personen aufzuwerten, von deren Anerkennung man sich abhängig fühlt. Es ist dann hilfreich, zwischen ausdrücklichen und impliziten Formen der Wertschätzung zu unterscheiden. Ich denke, dass die implizite Form, die sich in der korrekten Handhabung des Settings ausdrückt, für die Stabilität des therapeutischen Selbstgefühls genügt, aber auch unverzichtbar ist.
Unvergessen ist ein Patient, selbst Arzt mit psychotherapeutischer Ausbildung, der in einem desolaten wirtschaftlichen und persönlichen Zustand kam. Als er sich nach vielen Jahren einer niederfrequenten Analyse auf beiden Ebenen stabilisiert und einige Schicksalsschläge gemeistert hatte, verabschiedete er sich mit einer Flasche Wein, an die eine Karte gebunden war. Aufschrift: Mit Dank für langjährige treue Dienste.
Ich habe mich in meiner Darstellung auf Patienten beschränkt, weil ich bisher nur bei ihnen diese Form der manischen Abwehr beobachtet habe. Patientinnen, auch wenn sie selbst Medizin oder Psychologie studiert haben und diese praktizieren, haben in der Regel weit weniger Probleme, den Therapeuten in seiner Rolle zu akzeptieren und zu bestätigen. Bei den Männern tröste ich mich, durchaus im Modus der Amplifikation, mit zwei Geschichten.
Die erste bezieht sich auf die treuen Dienste und stammt aus dem Roman von Gustav Freytag Soll und Haben, in dem eine Szene beschrieben wird, in der die adelige Mutter einer Tochter, der zuliebe ein junger, tüchtiger Kaufmann große Opfer auf sich genommen und das Vermögen der Baronin gerettet hat, sich bei ihm für seine Dienste bedankt. Sie tut das auf eine Weise, die ihm völlig klar macht, dass sie in ihm nie etwas anderes gesehen hat als einen Domestiken mit Schnallenschuhen und gepuderter Perücke.
Die zweite Geschichte gilt ganz allgemein für die narzisstischen Männer und die Menschen, die diesen etwas beibringen wollen. Sie steht in dem italienischen Roman Il Gattopardo des Fürsten von Lampedusa und bezieht sich auf einen seiner Vorfahren. Dieser plauderte auf der Terrasse seiner Villa mit Blick aufs Meer mit einem britischen Offizier über die Sizilianer. Der Gast kam von einem der Kriegsschiffe, die während der Kämpfe Garibaldis im Hafen von Palermo lagen. Der Fürst wies auf diese Schiffe und sagte zu seinem Gast: They come, to teach us good manners. But they won’t succeed, because we are gods. Sie kommen, um uns Sizilianern gute Manieren beizubringen. Aber sie werden keinen Erfolg haben, denn wir sind Götter!
Dazu sollte man wissen, dass Sizilien damals eine der ärmsten Provinzen Italiens war.
[1] Ralph R. Greenson: Technik und Praxis der Psychoanalyse, Klett-Verlag 1973, S. 81. Die Sätze finden sich in einem Abschnitt zum Widerstand unter der Zwischenüberschrift: Häufige „fröhliche“ Stunden.
[2] Dörte von Drigalski: Blumen auf Granit. Eine Irr- und Lehrfahrt durch die deutsche Psychoanalyse. Frankfurt (Ullstein) 1980
[3] Sie sind in W. Schmidbauer: Die Ohnmacht des Helden. Unser alltäglicher Narzissmus, Rowohlt, Reinbek 1982 publiziert.
[4] Vergleiche W. Schmidbauer: Kaltes Denken, warmes Denken. Der Gegensatz von Macht und Empathie, Kursbuch-Verlag, Hamburg 2020
[5] W. Schmidbauer, Mythos und Psychologie. Methodische Probleme der Mythendeutung, aufgezeigt an der Ödipussage. Dissertation an der LMU 1969, als Buch erschienen 1970, ergänzte, 2. Auflage Reinhardt-Verlag, München 1999
[6] Vgl. W. Schmidbauer, Animalische und narzisstische Liebe, Klett-Cotta 2023 (Erscheint im Mai)