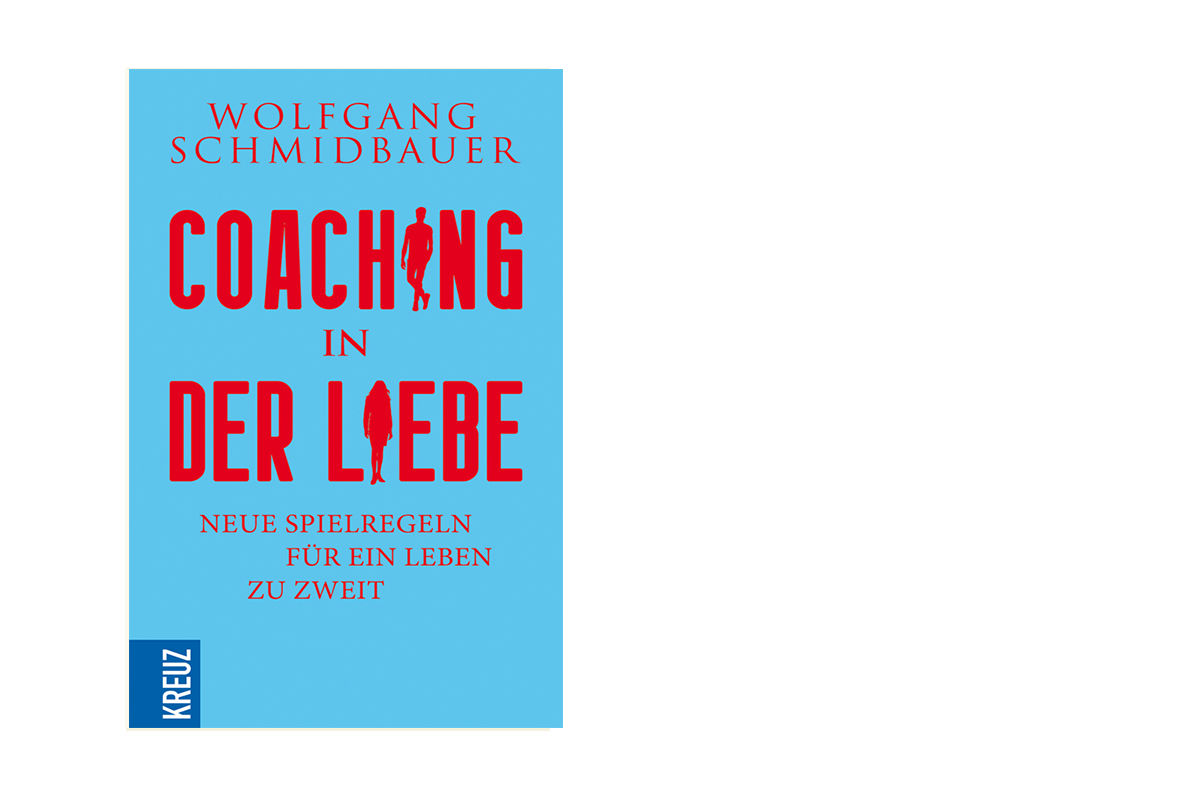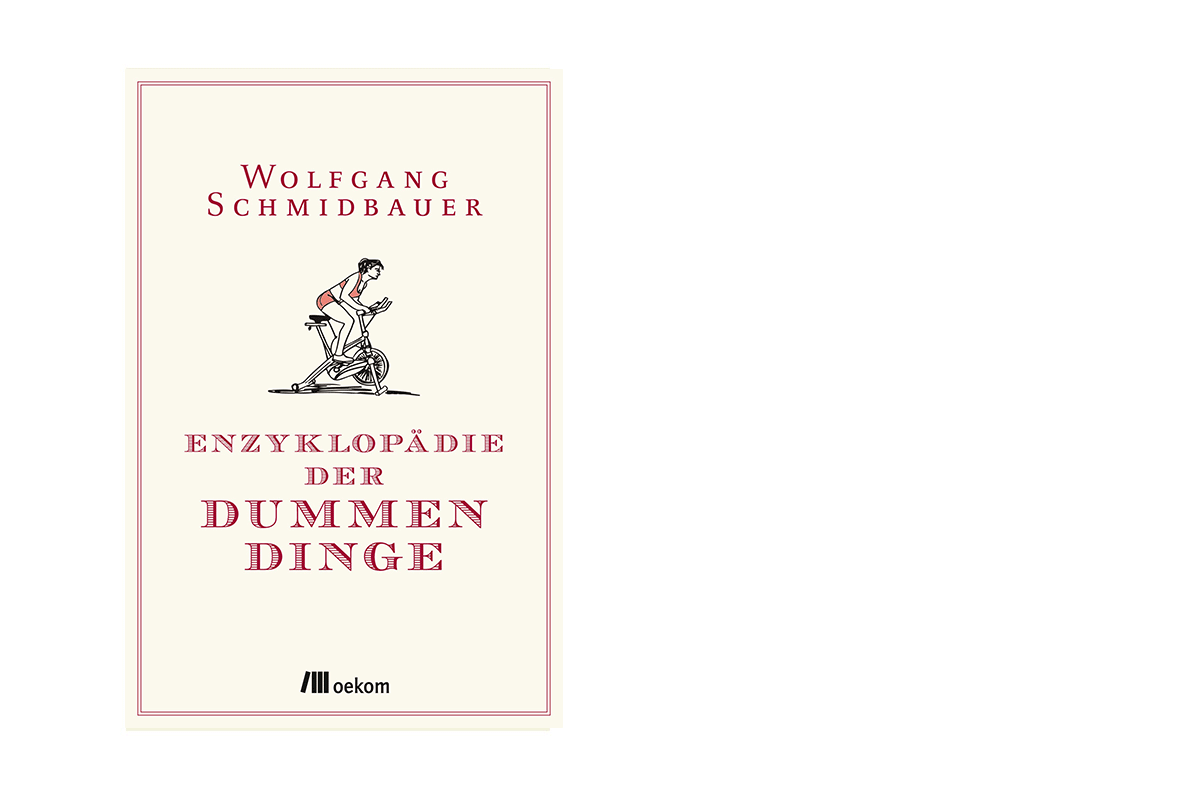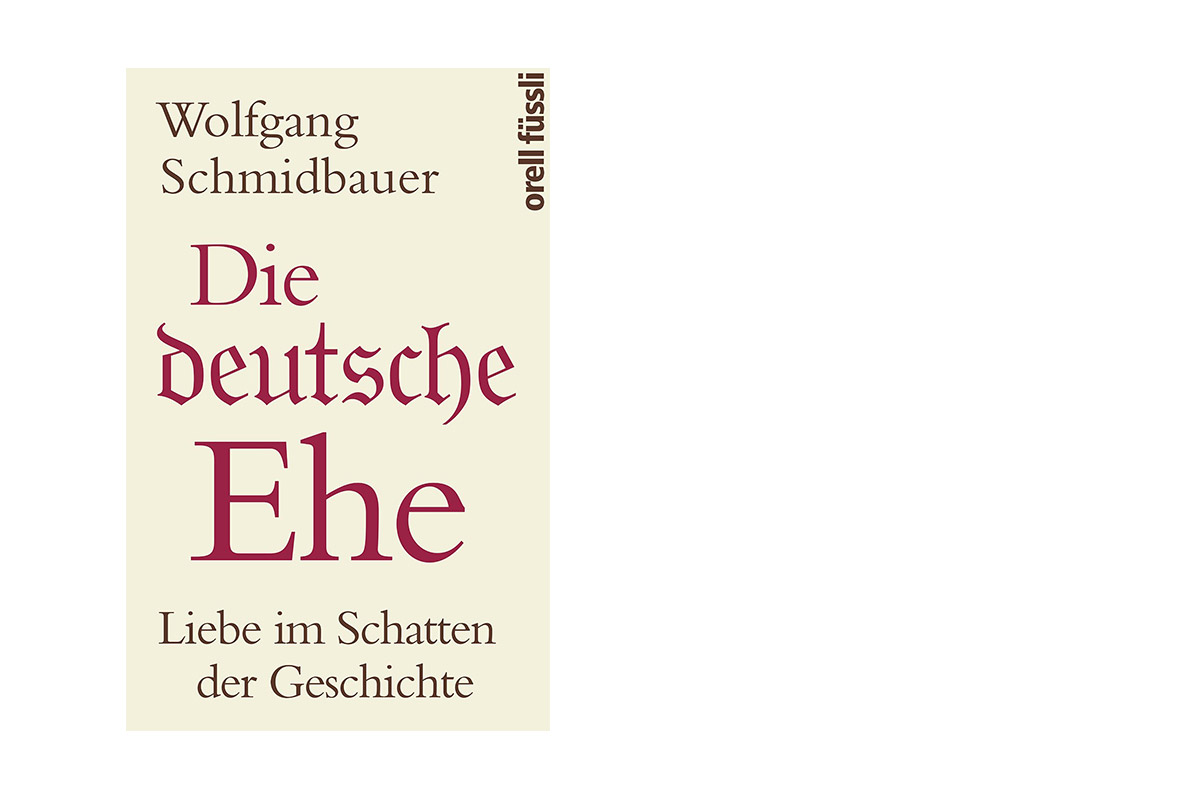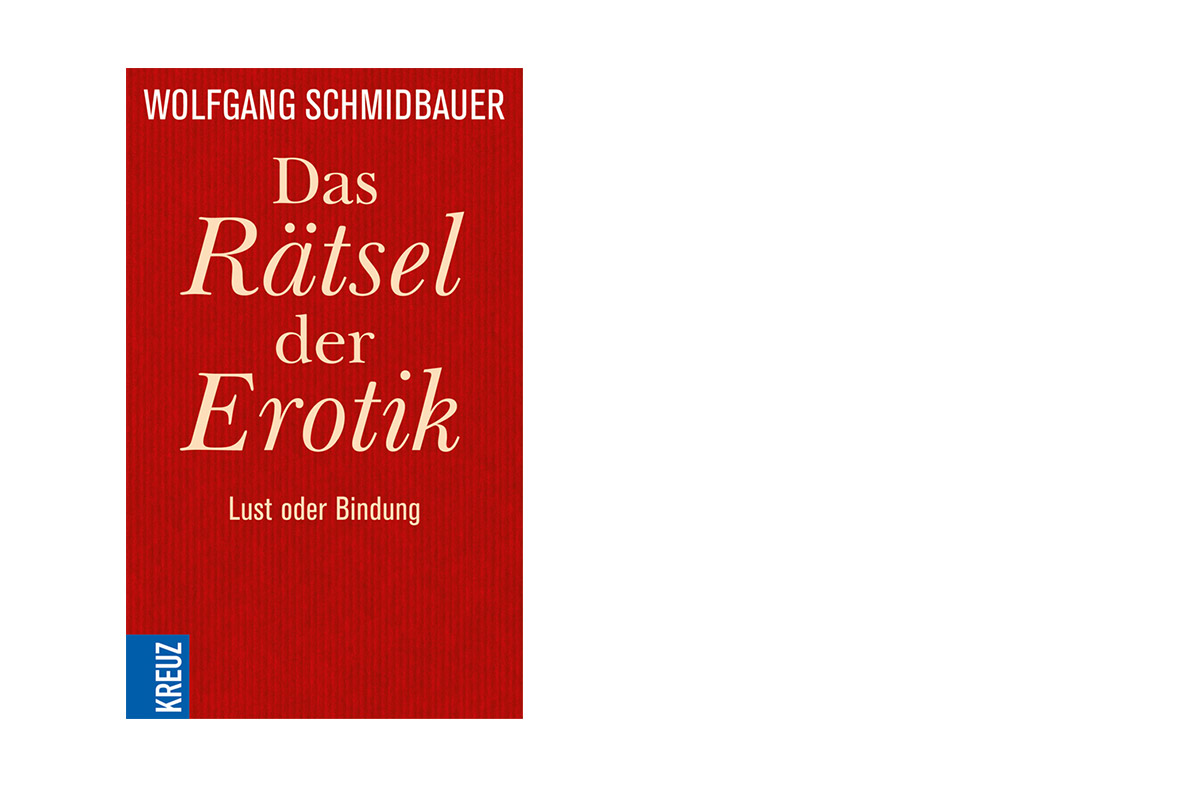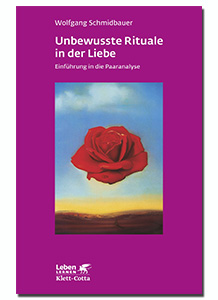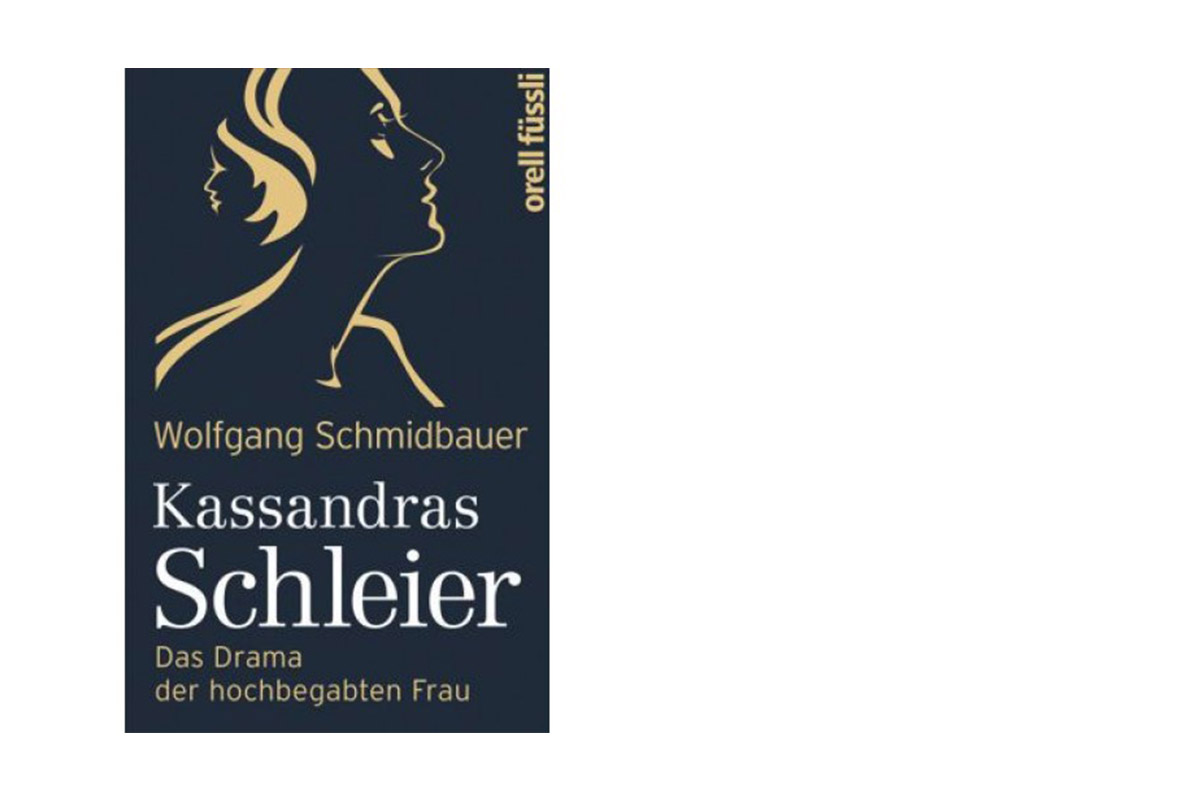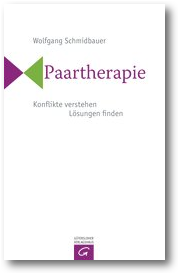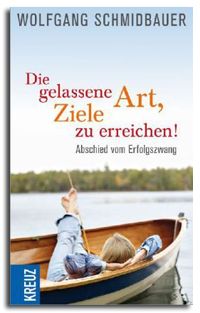Moderne Partner müssen sich gegenseitig unterstützen, um den Mangel an äußerem Halt in Traditionen auszugleichen.
Wolfgang Schmidbauer zeigt überzeugend und mit vielen Beispielen aus seiner langjährigen therapeutischen Praxis, wie Paare mithilfe der Erkenntnisse des Coachings Potenziale in der Liebe neu entdecken und für sich nutzen können.
Sie haben unseren Alltag bereichert und erleichtert: Kühlschrank, Dusche, Smartphone - darauf verzichten möchte niemand mehr. Wir nutzen diese Dinge heute völlig selbstverständlich, ohne darauf zu achten, wie sie - im Hintergrund unseres Lebens - Fühlen und Denken der Gesellschaft verändern.
In der deutschen Ehe entfaltet sich eine Dynamik, die allgemein wie speziell, sehr modern und doch die historische Folge sozialer Traditionen ist. Über 25 Prozent aller Ehen in Deutschland sind binational. Eine Kulturgeschichte der deutschen Ehe und wie nationale und kulturelle Eigenarten unsere Beziehungen beeinflussen.
Liebesbeziehungen beginnen knisternd und voller Freude aneinander. Später werden viele von ihnen lauwarm, ja kalt. Muss das sein? Wolfgang Schmidbauer geht der Frage nach und kann einige der Rätsel lösen, die hinter dieser Verwandlung stehen: Es geht darum, Lust und Bindung zu versöhnen.
Was hält Paare zusammen? Es ist die fragile Macht der »unbewussten Rituale«, die jedes Paar zu Beginn seiner Beziehung ausbildet. Allerdings können Rituale aufgekündigt werden und die gegenseitigen Bindungskräfte lassen nach. Die Methode der »Paaranalyse« kann Klarheit bringen.
Sie halten still, wenn sie über Dinge belehrt werden, die sie längst wissen. Sie erklären sich für beschränkt, weil sie eine törichte Frage nicht verstehen. So handeln Hochbegabte, die aus Angst vor sozialer Isolation und oft aufgrund traumatischer Erfahrungen ihre geistigen Fähigkeiten unterdrücken.
Häufiger Streit, brennende Eifersucht, unheilvolle Routine – es gibt Situationen in einer Beziehung oder Ehe, in denen die Schwierigkeiten so groß scheinen, dass man sie als Paar nicht mehr bewältigen kann. Und auch nicht weiß, ob man das überhaupt noch will...
Ablenkungsmöglichkeiten gibt es in unserer Gesellschaft ohne Ende; was nicht gefällt, wird weggezappt. Dranbleiben hat hingegen mit Gelassenheit zu tun, mit langem Atem...
Die Krise der heutigen Ehe: unglücklich durch ein Kind
Die Geburt eines Kindes ist in vielen zivilisierten Ländern die häufigste Ursache einer Scheidung in den ersten Ehejahren. Warum ist das so?
Was wir zum Überleben brauchen
Die globalisierte Konsumgesellschaft muss scheitern. Sollten wir daher nicht alles Mögliche tun, uns geistig und emotional auf die Improvisation von Rettungsflößen vorzubereiten?